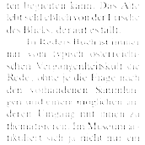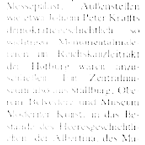|
Gespräch mit Walter Pichler
In orientalischen Städten gibt es inmitten des dichtesten
Bazarlebens kleine Betstuben, die eigentlich Ruheräume sind,
in die man sich zurückziehen kann; die großen Moscheen lassen
sich in gleicher Weise verwenden und die nach innen gekehrten
Häuser vervollständigen eine Typologie von Enklaven, für
die es in unserer Kultur keine Entsprechung gibt. Für Museen
ist immer wieder ein analoger Anspruch erhoben worden und
der abgeschiedene Bauernhof in St. Martin ist eine Enklave
Walter Pichlers, mit Atelierräumen und eigens für seine
Plastiken errichteten Gebäuden. Privates und Museales als
Abwehr von Öffentlichkeit ?
Bei mir kommt das daher, weil es heute für einen Bildhauer
so schwierig ist, einen Platz zu finden für seine Arbeit.
Für welchen Raum arbeitet er eigentlich ? Meine Plastiken
kann ich nicht auf Plätzen aufstellen, ich arbeite nicht für
Auftraggeber. Also nutze ich mein eigenes Terrain um meine
Vorstellungen zu verwirklichen. Eine Galerie ist für Skulpturen
keine gute Umgebung, für Ausstellungen kommt also nur ein
Museum in Frage. Das Museum ist für mich ohnehin immer ein
wichtiger Punkt gewesen, ein Teil meiner Arbeit, wegen meines
großen Interesses an alter, vor allem anonymer Kunst. Als
Bildungsstätte hat es für mich immer weit mehr Bedeutung gehabt
als die Akademie oder eine Schule.
Trotz der in ihrer Druckqualität immer besser gewordenen
Bücher ?
Ja, denn für Skulpturen ist die Reproduktion ziemlich ungeeignet.
Man muß sie unvermittelt anschauen können, so wie das auch
für Architektur notwendig ist. Man muß hinein- und rundherumgehen,
man muß sich bewegen können, muß ein Raumgefühl bekommen,
das Material spüren. Bei der Reproduktion einer Zeichnung
oder eines Gemäldes geht es sich noch aus, aber eine Plastik
muß man sehen. Auf meinen Reisen besuche ich natürlich immer
Museen, sie sind ein Bezugspunkt in jeder Stadt, so eine Art
Heimat - und zwar aus zwei Gründen. Erstens sind die Verwandten
da, über Jahrhunderte hinweg, inklusive der eingebildeten
oder überheblich gesehenen Verwandschaften. Zweitens brauche
ich das Museum als Gebäude, in das ich mit meinen Arbeiten
vorübergehend ziehen kann, wenn ich von St. Martin - das ich
nicht als Museum bezeichnen würde - weggehe. Ich muß mich
dort einrichten können, muß umbauen können, muß den Arbeiten
räumliche Situationen schaffen. Dazu brauche ich Mitarbeiter,
die kenntnisreich und hilfreich in jeder Form sind.
Als konsequente Herausforderung bis Überforderung des internen
Museumsbetriebes.
Sicher. Nur wenige Museen sind darauf eingestellt und haben
entsprechendes Personal. Gerade die modernen Museen sind erst
sehr langsam mit erstklassigen Leuten besetzt worden. Werner
Hofmann in der Kunsthalle Hamburg war so ein Anfang, obwohl
er eigentlich ein Spezialist für das 19. Jahrhundert ist.
Solche Vermischungen sind gut, ich ziehe sie einer reinen
Spezialisierung auf die Moderne vor, wie sie vor allem in
amerikanischen Museen stattfindet. Die Sammlung des Städel
in Frankfurt ist dafür ebenfalls ein Beispiel: phantastische
alte Kunst, fast ausgeglichen dazu die klassische Moderne
und aktuelle Kunst. Von meiner Denk- und Arbeitsweise her
brauche ich Rückkoppelungen über sehr lange Zeiträume und
Museen, die mir dazu etwas bieten, halte ich für ideal. Die
Möglichkeit zu Qualitätsvergleichen ist der springende Punkt,
selbst wenn sie meistens zu Ungunsten Lebender ausgehen. Das
hat mit dem Moloch Geschichte zu tun, aber auch damit, daß
das Konservierungsdenken der Museen fast immer zu einer stiefmütterlichen
Behandlung der zeitgenössischen Kunst führt.
Die Sammlungsstrukturen der großen klassischen Museen sind
praktisch immer chronologisch aufgebaut und zugleich regional,
national, mit Abteilungen für Italiener, Spanier, Niederländer.
Wären da im Sinn der eben genannten Überlegungen nicht radikale
Eingriffe anzustreben, z. B. im Wiener Kunsthistorischen
Museum, damit andere Abfolgen und Konfrontationen den Blick
sensibilisieren ?
Das würde ich nicht machen. Manchmal kann es gut sein, etwa
Picasso und afrikanische Skulpturen zusammenzubringen, nicht
aber im Sinn einer neuen Regel.
Im Calouste Gulbenkian Museum in Lissabon kann man sehen,
wie soetwas - wenn auch unter Ausschluß der Moderne - gelungen
ist, ohne daß deswegen gleich vom Dialog zwischen Kulturen
die Rede sein muß. Gewachsene Sammlungen müßten jedenfalls
mit enormer Akribie neu durchdacht werden, um sie im Rahmen
"größerer Lösungen" in sinnvoller Weise umzugruppieren.
Mit den üblichen planerisch-bürokratischen Akten ist soetwas
kaum vorstellbar; und das ist doch ein wichtiger Punkt für
die Entwicklung künftiger Museumsstrukturen.
Das glaube ich auch. Schon im Persönlichen gibt es da beklemmende
Blockaden. Bei im Bereich der klassischen Kunst kenntnisreichen
Leuten habe ich allzuoft einen Haß auf die Moderne oder zumindest
ein sehr abwertendes Verhalten ihr gegenüber festgestellt.
Umgekehrt ist es ähnlich. Diejenigen, die ausschließlich mit
aktueller Kunst zu tun haben laborieren deswegen meistens
so zeitgeistig herum, weil ihnen ein Zugang zum Vergangenen
fehlt. Auf beiden Seiten würde ich mir persönliche Vorlieben
wünschen, die sind unbedingt notwendig, nur müßte das längst
nicht so isoliert voneinander passieren. Expertenhaftigkeit
ist dabei gar nicht Voraussetzung, es würde genügen, sich
mit Interesse und Konsequenz die Sachen vergleichend anzuschauen.
Gegen Themenausstellungen, selbst gegen Gruppenausstellungen
hat es aber in Wiener Künstlergesprächen immer heftige Vorbehalte
gegeben. Gilt diese Skepsis den vergleichenden, Kunst einer
Idee oder einer Beweisführung unterordnenden Ausstellungen
schlechthin ?
Ja, denn das ist eine Unsitte geworden. So qualifizierte
Leute wie Harald Szeemann oder Rudi Fuchs haben sich ihre
Themen vorgenommen, als Konkurrenz der Ausstellungsmacher
gegenüber dem Künstler, weil sie sich anscheinend in ihrer
eigenen künstlerischen Kreativität etwas zu kurz gekommenen
fühlen. Es gibt genügend Aussprüche aus dieser Richtung, nach
denen der Künstler nicht mehr der wirklich kreative Mensch
ist, sondern in Wahrheit der, der etwas zusammenstellt. Kunstausstellungen
werden so zum eigentlichen Akt der Kreation hochstilisiert.
Auch wenn es gute Beispiele gegeben hat war das für mich immer
irgendwie unseriös.
Der Drang zur Einzelausstellung bis hin zu ihrer autonomen
Gestaltung ist plausibel, deswegen kann man doch umfassendere
Konzepte nicht völlig ablehnen ?
Das will ich auch nicht. Es hängt von der Arbeit ab. Manche
Künstler stellen eben gerne in Gruppen aus, manche werden
in Themenausstellungen sogar verständlicher. Ich aber war
zum Beispiel in der Manierismus-Ausstellung von Werner Hofmann
völlig deplaziert. Das ist ein Mißverständnis gewesen. Diese
Ausstellungen sind meistens zu unpräzise. Es ist so wie mit
den Biennale-Themen in Venedig, an die sich dann sowieso kein
Mensch hält. Künstler gehen inzwischen sogar soweit, daß sie
etwas extra für ein vorgegebenes Thema produzieren. Mir kommt
das vor wie bei einer Meinungsumfrage, die Marktlücken aufspüren
soll. Ich bin natürlich dafür, daß das zentrale Thema der
Künstler zu machen hat. Es handelt sich um seine Arbeit und
je präziser und genauer er sie darstellen kann, desto mehr
macht er sich verständlich, desto angreifbarer wird er auch.
Kunst, die sich für sich allein in einem Raum schützen
will, wird dann zugleich ein Manifest gegen die beliebige
Flut der Bilderwelt rundum ?
Ja. Das ist nur eine Frage der Präzision. Und damit sind
wir beim Künstlerbild. Eine Ausstellung ist das Medium, wo
der Künstler so präzis wie möglich seine Absichten erklären
muß. Dabei helfen ihm keine nochso guten Texte im Katalog.
Im Atelier ist das anders, weil man dort zu zweit oder in
einer kleinen Gruppe miteinander umgeht. In einem Museum aber
muß man sehr viele Begleitmaßnahmen treffen, um seine Absichten
und Gedankengänge so klar wie möglich zu machen. Wenn also
dort Kunst in überlegter Weise geschützt wird, so zeigt das
in sehr bestimmter Weise, daß sie im Überangebot von Ausstellungen
und unverdaubaren Kreativerzeugnissen eben andere Ansprüche
erhebt, sich also abhebt von geschickt präsentierten Automodellen
oder einer cleveren Darbietung irgendwelcher Konsumartikel.
Auch Kunst muß man konsumieren, aber die Art der Konsumation
muß eine andere sein. Sonst frage ich mich, wozu wir das überhaupt
noch machen.
Der Künstler, der Bilder oder Zeichnungen herstellt, verliert
ja, sobald er sie hergibt, den Einfluß auf seine Arbeit.
In eigenen Ausstellungen kann er um ihn noch kämpfen, sei
es in bezug auf die Hängung oder durch Mitwirkung am Katalog.
Die Plastiken in St. Martin werden bewußt einer solchen
Gefährdung entzogen.
Ich bin eben den radikalen Weg gegangen und habe sie aus
dem Markt herausgenommen. Ich verkaufe sie nicht. Sie bleiben
in meiner Nähe und eröffnen mir ganz andere Produktionsmöglichkeiten.
Es ist - wenn man von einem weit gefaßten Museumsbegriff ausgeht
- doch ganz egal, wo auf der Welt eine Skulptur steht. Sie
muß nur existieren. Wer sich dafür interessiert, weiß um sie
aus Publikationen. In meinem Fall zeige ich meine Arbeiten
von Zeit zu Zeit in einem Museum her. Das macht deutlich,
wie eng der übliche Museumsbegriff geworden ist. Es dreht
sich nicht alles um die großen Kästen in den Metropolen. Man
kann zu den entlegensten Orten reisen und sich etwas anschauen
und es ist gar nicht notwendig, daß z. B. Skulpturen dauernd
hin und her transportiert werden.
Ihre Existenz wird über Publikationen mitgeteilt, das Original
braucht also die Öffentlichkeit nicht ?
Nicht im Sinne eines Glaubens an die große Zahl. Der ist
eine Sache von Politikern. Es ist ihr grundlegender Irrtum
zu meinen, je mehr Leute Kunst anschauen, desto mehr haben
sie von ihr. Enteder will man wirklich Kunst herzeigen und
gibt ihr daher jene Wichtigkeit, die sie hat und von der alle
bereits in einer Weise reden, daß es einem unheimlich wird
oder man gibt zu, daß gar nicht Kunst gemeint ist, sondern
ein Fremdenverkehrskonzept. Ich habe immer die Theorie vertreten,
daß im Centre Pompidou Reproduktionen genügen würden. Die
20.000 Besucher pro Tag ließen sich dadurch nicht abhalten.
Schauen wir uns doch Venedig an, das ja, wenn man will, ein
einziges Museum ist. Ich komme gerade von dort: Sie brechen
alle zusammen. Keiner kann mehr die Schönheit dieser Stadt
sehen, so wie im Pompidou keiner mehr ein Bild sehen kann.
Dieser Weg führt doch nirgends hin. Kunst hat viel mit Sorgfalt
zu tun. Wenn Künstler schon so komplizierte Sachen machen,
wie ein Bild von der Welt, nicht mehr und nicht weniger, so
kann das doch schließlich nicht in zwei Minuten abrufbar sein,
bei der geballten Information, die enthalten ist.
Dazu fällt mir eine konträr interpretierbare Aussage von
Arnulf Rainer ein, in der er dem gemalten Bild gerade deswegen
eine so dominante Kraft zuordnet, weil es alle seine Möglichkeiten
auf einer kleinen Fläche konzentriert und sie praktisch
im Moment mitteilen kann. Wie die dann wirken, welcher Zeitablauf
nachher einsetzt, ist offenbar eine andere Sache.
Wenn das so ist, trifft es auf die Skulptur umso deutlicher
zu. Da bewegt sich überhaupt nichts mehr. Ihre Körperlichkeit
bringt sie wirklich nur im Original. Das müßte dann auch für
das Bild gelten, für seine Einzigartigkeit. Beim Abbild wäre
es vorbei mit der dazu notwendigen Präsenz.
Können aus dem Vorgang, wie ein Künstler heutzutage mit
größtmöglicher Präsenz in ein Museum eindringen kann, beispielhafte
Forderungen an dessen Arbeitsweise abgeleitet werden ?
Ausgangssituation ist das Atelier, die konkrete, sehr intime
Arbeitsumgebung. Bei mir ist sie deutlich erweitert, weil
es Häuser gibt, in denen nicht mehr gearbeitet wird. Es ist
aber der generelle Kontext mit der Produktion da, mit dem
schöpferischen Bereich, wo manches fertig, manches halbfertig
als Zeichen von Prozessen da ist, noch nicht aus ihnen entlassen.
Wenn ich nun mit solchen Arbeiten in ein anderes Haus, in
ein Museum, hinausgehe, muß ich diese Selbstverständlichkeiten
vergessen, muß mir ein komplett anderes Konzept erarbeiten.
Ich muß die Plastiken wirklich herausnehmen aus meiner - und
ihrer - Umgebung. Zeichnungen sind ihnen gegenüber ungebundener;
sie finden ihren Weg, hängen irgendwo gerahmt, vielleicht
in einem Zusammenhang untereinander, aber das ist gar nicht
so wichtig. Für die Plastiken hingegen muß eine völlig neue
räumliche Situation geschaffen werden. Dabei geht es um drei
Stufen: Um die Qualität der Arbeit selbst, um die Sockel und
um die architektonische Lösung. Viele gute Bildhauer sind
in den beiden letzteren Gebieten hilflos oder untalentiert.
Dagegen muß angekämpft werden. Es ist doch ganz entscheidend,
in welcher Materialsituation, in welchem Umfeld, in welchen
Lichtverhältnissen sich eine Plastik erklären kann. Als Künstler
habe ich die Aufgabe, ihr möglichst optimale Bedingungen dafür
zu schaffen.
Deswegen handle ich immer exakt meine diesbezüglichen Forderungen
aus, wenn eine Museumsausstellung vorbereitet wird. Im Falle
des Museums für angewandte Kunst in Wien, wo ich 1990 ausstellen
werde, treffe ich auf einen Idealfall, da das Haus selbst
in einer kompletten Umstrukturierung begriffen ist und diese
Offenheit kommt meinen Überlegungen natürlich sehr entgegen.
Die letzte Ausstellung im Städel in Frankfurt war ein Beispiel,
daß es mit einigen radikalen Eingriffen durchaus möglich war,
Räume einschneidend zu verändern, Unnützes zu eliminieren
und durch die Öffnung ursprünglich verschalter Fenster neue
Lichtverhältnisse und einen Kontext zur Stadt herzustellen.
In der Zusammenarbeit mit Peter Noever gehen wir wesentlich
weiter. Da alles in diesem Haus in Bewegung ist, kann ich
mich in diese Bewegung einkoppeln und wir können etwas machen,
was im besten Sinn des Wortes museal ist. Ich werde dort meine
Sache machen und zugleich dem Museum Dauerhaftes hinterlassen;
einen neuen Durchbruch zum Garten beispielsweise. Bei aller
verständlicher Statik, die ein altes Haus hat, muß es zugleich
eine Flexibilität schaffen - vor allem eine räumliche - damit
drinnen fast alles möglich ist. Man muß z. B. die Beleuchtung
ändern können, die Raumproportionen, die Höhen, die Böden.
Mit den üblichen Stellflächen, die Wände nur vortäuschen,
ist nichts dergleichen möglich. Das sind Konzeptionen der
50er Jahre, die modern sein wollen. Selbst das Pompidou hat
nichts besseres. Jedes alte Museum mit Wänden, in die sich
Nägel einschlagen lassen ist dem überlegen.
Überlegen ist jedem noch so modernen Museum auch jede Oper
und jedes halbwegs ausgestattete Theater, wenn man deren
Variabilität punkto Bühnenmaschinerie, Umbauten, Beleuchtung
oder Kriterien wie Akustik, Personaleinsatz bis hin zu Sicherheitsvorkehrungen
als Maßstab nimmt.
Das sagt über die Bewertung bildender Kunst ja einiges aus.
Im Museum ist Kunst sozusagen der alleinige Hauptakteur, während
es sonst hauptsächlich um Interpretation und um den Sekundäraufwand
von Inszenierungen geht. Wir dagegen müssen uns überall mit
den lächerlichsten und primitivsten Vorrichtungen herumschlagen,
selbst in ganz neuen Häusern. Im Prinzip ist eine Halle notwendig,
in der du einfach alles aufführen kannst, mit jeder Möglichkeit
der Technologie. Es muß jede Art von Beleuchtung möglich sein,
vom Tageslicht bis zu ausgeklügelten Systemen, es muß möglich
sein Wände hineinzumauern, das Klima muß stimmen, man muß
die Böden streichen oder verändern können. Die Wahrheit ist:
Man braucht eine Baustelle.
Aus solchen Baustellen wird nur etwas werden, wenn auf
ihnen qualifizierte Arbeit geleistet werden kann. Kein noch
so spartanischer Regisseur könnte auf Dauer die in Museen
auf diesem Gebiet herrschende Situation akzeptieren.
Wir haben bisher die Architektur besprochen, als eine der
Voraussetzungen. Die wahrscheinlich noch wichtigere sind die
Leute, die an solchen Projekten mitarbeiten. Ein Museum ist
ja nicht bloß eine Hülle mit Installationen drinnen. Auf eine
intensive Ausstellungsarbeit ist es normalerweise gar nicht
ausgerichtet. Man kommt als Fremdkörper, als Störenfried.
Ich arbeite daher grundsätzlich mit meiner eigenen Mannschaft,
habe es aber immer zusammengebracht, daß wir ganz gut mit
den hauseigenen Leuten kooperieren konnten. Oft hat die administrative
Crew am Handwerklichen mitgetan und die Handwerker haben bürokratische
Sachen erledigt.
Schwer haben es normalerweise die vom Direktor bestimmte
Ausstellungsbetreuer, in der Regel Kunsthistoriker; sie stehen
zwischen den Fronten, müssen die Hausquerelen auffangen und
sind von vorneherein ohne den ihnen - auch einkommensmäßig
- gebührenden Status. Dennoch glaube ich, daß solche Einbrüche
in den Museumsalltag auch von diesen Aspekten her ein Gewinn
für alle Beteiligten sein können. Normalerweise sind sie nämlich
nur Routine gewohnt und die gelegentlich übernommenen Ausstellungen,
die mit der Spedition und kunsthistorischer Begleitung anrauschen
und so schnell wie möglich auf Wände plaziert werden müssen,
von denen vorher vielleicht noch manche braun oder gelb gestrichen
werden.
Das spricht für eine kulturelle Situation, in der Museen
über eine adäquate personelle Grundausstattung verfügen,
Ausstellungsteams aber primär aus Freischaffenden zusammengesetzt
werden.
Für die Standardfunktionen braucht das Museum möglichst gute
Mitarbeiter, bis hin zu Werkstätten und Aufsehern. Projekte
aber werden sich mit von außen kommenden Leuten kompetenter
realisieren lassen.
In Österreich ist es erst im Anlaufen, international aber
hat das Starsystem längst schon die Museumsdirektoren erfaßt;
eine Handvoll Prominenter wie Pontus Hulten beherrschen
die Szene, während der restliche Apparat, inklusive des
sogenannten Mittelbaus, völlig im Schatten steht, ganz im
Sinn überwunden geglaubter autoritäter Systeme. Zugleich
werden die Chefs von den widersprüchlichsten Anforderungen
und Zwängen zermahlen.
Ein gutes Beispiel dafür ist Rudi Fuchs. Er war bekanntlich
Documenta-Macher, ist zum Star geworden, hat im Van Abbe Museum
in Eindhoven ein sehr gutes, kleines Team gehabt. Das ist
noch dort, er ist weg und arbeitet primär als fliegender Ausstellungsmacher,
also nach dem sich schon in den 70er Jahren nicht bewährenden
Konzept. Der Druck ist enorm, weil doch solche Leute - vor
allem wenn es um die gerade aktuelle Kunst geht - mit bestimmten
Künstlergruppen identifiziert werden und automatisch die zugehörigen
Galerien und Medienleute an der Hand haben müssen. Ab einem
gewissen Punkt wird eine solche Museumsarbeit eben zur Legitimierung
von Galeriearbeit und damit zur Legitimierung von Preisentwicklungen.
Es sind ja auch alle Künstler rund um Baselitz schon früh
von ihm ausgestellt worden, auf die Dokumenta gekommen und
dann weiter auf die Biennale geschickt worden. Der klassische
Weg also. Museumsleute wie er geben dem ganzen den letzten
Schliff; so wird es "wirklich". Und sie selbst werden damit
auch zu Stars, in Symbiose mit den von ihnen forcierten erfolgreichen
Künstlern.
Bleiben wir bei solchen Schicksalen. Die Forderung nach
- im Idealfall - sehr kenntnisreich und sensibel agierenden,
starken Museumsdirektoren ist eine Forderung nach personeller
Privatisierung, da doch öffentliche Einrichtungen für sehr
private, subjektive Philosophien benutzt werden und ein
öffentlicher Kritik- oder Kontrollmechanismus in dieser
bizarren Medienwelt längst aus den Fugen geraten ist. Was
soll sie also sein, die Autonomie des Museums ? Der Künstler
will verständlicherweise mit kompetenten, kenntnisreichen,
entscheidungsbefugten Leuten kooperieren - er will also
eigentlich Partner für die privatistische Benutzung von
öffentlichem Raum.
Ohne dem geht es nicht. Ein Museum, wie wir es beschrieben
haben, ist ohne Persönlichkeit, die diesen Apparat auch führt,
nicht denkbar. Natürlich hängt alles davon ab, wie sie diese
Chance nützt. Ein gutes Museum wird es allerdings nur geben,
wenn drinnen viele gute Leute arbeiten. Der Chef oder die
Chefin wird ein Star sein, das wird sich nicht vermeiden lassen;
denn irgendwer muß ja den Kontakt mit dem Künstler aufnehmen,
muß entscheiden, wer ausgestellt wird und wer nicht.
Nur ist die Hoffnung auf Integrität, wie bereits angesprochen,
sehr illusionistisch. Krass gesagt sind gerade zeitgenössische
Museen voll in Marktinteressen eingebunden. Wer sich da
dagegen stellt, hat vielleicht eine Zufallschance. In Österreich
wird das vielleicht noch nicht so deutlich gesehen, weil
der Museumsbetrieb noch zu verschlafen ist.
Daß die Legitimierung durch das Museum die hohen Preise erzeugt
ist klar. Daher kann dieses Spiel auch nicht ohne Interessen
und Interventionen ablaufen. Nichteinmal die Abgrenzung zwischen
Museen und Galerien funktioniert noch. Es gibt nur noch Verwechslungen.
Agile Museen agieren wie Galerien, Galerien glauben, sich
als Museen gebärden zu müssen. Mir geht es diesbezüglich ganz
gut, weil ich mich mit meiner Arbeit von diesen Mechanismen
der Preisbildung fernhalte, sozusagen als Gegenargument. Meine
zentralen Arbeiten kommen nicht in den Handel, also gibt es
- auch nach Museumsausstellungen - keine auffallenden Preissteigerungen.
Wir sind von der Kunstproduktion, von Sammlungen und von
Ausstellungen her an Museumsfragen herangegangen; wir sollten
uns jetzt mit dem "Rest" beschäftigen, dem permanenten Innenleben.
Von der wissenschaftlichen Arbeit in einem Museum kann ich
mir trotz meiner jahrzehntelangen Liebe zu solchen Institutionen
noch immer erst ein sehr ungefähres Bild machen. Die jüngeren
Kunsthistoriker, die ich kenne, haben alle schon das Ideal
des Ausstellungsmachers. Archivarbeit und Katalogisieren ist
nicht ihr Thema.
Unübersehbar ist aber, daß sich die alten Aversionen zwischen
"Historikern" und zeitgenössischen Produzenten verflüchtigen.
Ich hoffe das. Die Albertina ist dafür ein Extrembeispiel
gewesen. Dort haben sich alle als Verwalter der ewigen Werte
aufgespielt und jeden lebenden Künstler als unerwünschten
Eindringling empfunden, der froh sein mußte, in diesem erlauchten
Hause ausstellen zu dürfen. Was dann tatsächlich ausgestellt
worden ist, hat diesen Anspruch so diskreditiert, daß er nur
mehr grotesk war. In der Ära Koschatzky hat jede Hilfskraft
vermittelt bekommen, daß sie der Ewigkeit näher sei, als irgendwer
von den Lebenden, der mit seiner Kunst aufgetaucht ist. Das
zeigt sich alles ganz deutlich in der Sammlung, die während
dieser Jahre angekauft worden ist. In fahrlässigster Weise
ist die Pflicht verabsäumt worden, signifikante gegenwärtige
österreichische Kunst zu sammeln. Nebenbei war das auch eine
enorme Vergeudung von Volksvermögen und niemanden in der Kulturpolitik
hat das im geringsten gestört. In der weltberühmten Albertina,
deren graphische Sammlung doch auch Gedächtnisfunktionen hat,
existieren unsere wichtigsten künstlerischen Phasen dieses
Jahrhunderts also nur als weiße Flecken.
Wenn in dieser Richtung Ignoranz ein deprimierendes Thema
ist, bekommt für mich nochmals die Frage nach neuen Formen
der Vermittlungsarbeit, nach Museumspädagogik - so internatsmäßig
das auch klingen mag - ein Gewicht, als Ausbruch aus dem
Ghetto der (angeblich) Kenntnisreichen.
Ich habe damit große Probleme und bin skeptisch, daß man
so in bezug auf ein Verständnis von Kunst erfolgreich sein
kann. Menschen die sich auf Kunst eingelassen haben, sind
doch ganz anders, über sehr private, verzweigte, obsessive
Prozesse zur ihr gekommen, nicht über einen Kindergartenbetrieb,
über Malkurse oder brave Führungen. Ich selbst habe doch auch
keinerlei Methodik dafür gehabt. In Tirol bin ich vielleicht
einmal mit der Schule im Volkskundemuseum gewesen. Es ergibt
ja auch keine Proportion für die Museumsarbeit, wenn die sogenannte
Vermittlung ein zu großes Gewicht hat. Kindermalkurse sind
keine hauptsächliche Arbeit eines Museums.
Das sind alles so Funktionen, die der Kunst in den letzten
Jahren zugeteilt werden. Was soll sie denn noch alles leisten
? Alle diese Fragen, die niemand erledigen kann, werden jetzt
der Kunst aufgebürdet. Von den Umweltkatastrophen ist nur
mehr am Rande die Rede, dafür hat jetzt jeder Politiker seinen
Hauskünstler. Gegenseitig will man plötzlich zur selben Gesellschaft
gehören und alle an diesem Gefühl teilhaben lassen, nach dem
Motto: Die Künstler waren jahrhundertelang ausgeschlossen
- wie sie behaupten, was aber in dieser Generalisierung einfach
nicht stimmt - und jetzt endlich gehören wir zueinander. So
gesehen hängt das natürlich wiederum alles zusammen. Du hörst
ja deswegen auch niemehr die Frage, ob die Kunst die Gesellschaft
verändern kann.
Sie wird zur Lifestyle-Frage transformiert.
Ja, es geht nur mehr um Lifestyle. Die Gesellschaft hat sich
überhaupt nicht verändert, im Gegenteil, sie ist zynischer
und schlechter geworden - vielleicht auch deswegen, weil die
Kunst so unheimlich gut eingebunden worden ist, als pure Kosmetik.
Das bringt sie um ihre letzte Wirkung, jene nämlich, daß man
nicht so genau weiß, ob sie noch als Unruhestifter auftritt,
oder ob sie einfach nur noch "ein bißchen" zuwenig leicht
erfaßbar ist für einen schrankenlos-zeitgeistigen Konsum.
Jedem Kind redet man doch inzwischen ein, daß es Kunst begreift,
nur weiß es in Wahrheit weniger als vorher.
Joseph Beuys hat im Museum den Ort der permanenten Konferenz
gesehen; geworden ist daraus ein Zug der Lemminge, im besten
Fall ein Filmerlebnis mit zusammenhanglos vorbeiziehenden
Bildern. Aufklärende Funktionen wollte ihm anscheinend keine
Seite zumuten.
In Wahrheit bin ich selten so kompromißbereit wie in dieser
Frage, die Beuys so ernst genommen hat. Seine Konzeption ist
mir sehr wichtig geblieben, nur wäre es schwachsinnig, sie
bedenkenlos zu übernehmen. Kunst ist ein sehr geheimnisvolles
Gebiet. Wenn dieses Geheimnis nicht mehr ergründet wird, sich
also niemand die Mühe macht, zu untersuchen, ob man tatsächlich
ein Geheimnis vor sich hat oder nicht, dann wird Kunst außer
Kraft gesetzt. Die Folgen davon sind doch ständig zu sehen:
Der Respekt gegenüber Dingen, wo kein Respekt notwendig ist
und die Respektlosigkeit dort, wo höchste Aufmerksamkeit angebracht
wäre. Ein Hermann Fillitz vom Kunsthistorischen Museum ist
das beste Beispiel dafür, stellvertretend für die Wiener Zustände:
Kunstferne Mediengeilheit, ob es was bringt oder nicht.
Das führt nun doch noch deutlicher zum Konkreten, zur Situation
der Museen in Wien.
Mir sind auch nur die konkreten Beispiele wichtig. Das 20er
Haus etwa ist eigentlich von Anfang an ein unmögliches Museum
gewesen. Es ist ja der wideraufgebaute Weltausstellungspavillon
aus Brüssel, und völlig ungeeignet für Ausstellungen. Aber
Alfred Schmeller, der Direktor der späteren 60er und beginnenden
70er Jahre, der selbst eine zwar offene aber gar nicht so
entscheidende Person gewesen ist, hat seine damals wirklich
tolle Mannschaft ganz selbständig arbeiten lassen. Ich habe
nie geglaubt, daß man in Wien das machen kann. Die sind mitgezogen
bei den kompliziertesten Umbauten und da sind wirklich gute
Ausstellungen zustandegekommen. Ein anderer Fall: Ich habe
ja Wunderkammern sehr gern, so wie das Völkerkundemuseum eine
ist. Das vermittelt noch diesen Eindruck als Museum eines
Museums, das aus einer anderen Welt stammt und noch keinen
Gestaltungsplunder aufgenommen hat, wie ein kleines Provinzmuseum,
das neben der Zeit steht.
So lassen sich aber doch Gestaltungsfragen nicht auf alle
Zeiten ausklammern. Der Realität entspricht viel eher eine
etwas panische Modernisierungsstrategie, Designer kommen
zum Zug, Inszenierungen und Formalitäten werden neu überlegt,
meist völlig abgelöst von inhaltlichen Konsequenzen.
Das rechne ich zum Bündel der in Gang befindlichen Verirrtheiten.
In Architekturfragen nimmt sich jeder - im besten Fall - einen
Star. Der wird aber nicht das machen, was ich mir unter einem
Museum vorstelle. Selbst wenn seine Arbeit noch so gelungen
ist, betrifft sie noch nicht das System. Dessen wichtigstes
Prinzip müßte es sein, daß die Arbeitsbedingungen für alle
wirklich gut sind und sie sich möglichst viel außer Haus umschauen
können.
Angesichts der schon besprochenen Funktionsverschiebungen
ist zugleich zu fragen, ob es nicht verstärkt das Museum
ohne Haus geben sollte, das sich die Aura an wechselnden
Orten neu erkämpfen muß.
Die Ausstellungsmacher haben das ja mit wechselndem Erfolg
versucht. Ich glaube, daß es beides geben muß, die ortsungebundenen,
fliegenden Akteure und die solide Arbeit in einem Haus. Das
ergibt auch eine anspornende Konkurrenz.
Wir beziehen uns weiterhin vor allem auf eine Ausstellungstätigkeit,
auf ein wechselndes Angebot also. Normalerweise herrscht
gerade in den Wiener Museen eine - von wenig beachteten
Kleinausstellungen unterbrochene - Statik vor. Die Ereignisse
finden anderswo statt. Ist es überhaupt plausibel, unter
den gegebenen Bedingungen von den Museen mehr Sonderausstellungen,
wie die kommende über Rudolf II., zu fordern ?
In den 60er Jahren hat es diesbezüglich bereits eine sehr
gute Tradition gegeben. Ottokar Uhl hat z. B. im Völkerkundemuseum
eine Korea-Ausstellung gemacht, als von außen kommender Architekt
- das Plakat dafür stammt übrigens von mir - und er hat gemeinsam
mit den Museumsleuten, aber eben mit dem unprogrammierten
Blick des Fremden dort in Ruhe eine sorgfältige Sache konzipiert.
In diesem Sinn sollte man von Zeit zu Zeit Leute aus völlig
anderen Gebieten einbeziehen, weil damit die Chance für andere
Blickwinkel gegeben ist. Das meine ich jetzt sehr konkret,
denn ich habe die Residenz-Verlag-Bücher über die großen Wiener
Museen gestaltet und überall gesehen, wie man aus dem Bestand
bestimmte Objekte viel besser hätte zur Wirkung bringen können.
Dennoch: Von unseren Museen gehen fast durchwegs keine
öffentlichen Erregungen mehr aus, Erregungen der Freude,
des Erstaunens, der Irritation; sie bewegen also kaum etwas.
Der ersten Phase ihrer Kommerzialisierung - wo alle in der
ganzen Welt geplündert haben, um die Museen zu füllen - haben
sie wenigstens ihren Kampf um bürgerliche Öffentlichkeit,
um ein allgemeines Recht auf Bildung entgegengesetzt. Der
jetzigen, viel schlimmeren Phase ihrer Kommerzialisierung
sind sie eben fast wehrlos ausgeliefert, eingebunden in administrative
und machtpolitische Verflechtungen, umgeben von anonymen Zerstörern.
Wir haben diese Überlegungen zu Museumsfragen mit eher
melancholischen Gedanken über Enklaven begonnen, über Enklaven,
die vielleicht bloße Fiktion sind. Sind sie tatsächlich
eine wahrnehmbare Differenzierungsmöglichkeit oder sogar
die andere, ausstrahlende Form von Integration ?
Enklaven werden immer notwendiger. Das Unabhängigwerden wird
immer notwendiger. Einzeln zu denken wird immer notwendiger.
Enklave heißt also möglicherweise schon, daß du bewußt Dinge
nicht tust. Es geht, wenn du willst, um ein Querdenken, das
ist das echte, authentische. Das fasziniert ja auch die wachsamen
unter den ratlosen Politikern und Managern immer mehr.
Während meiner Ausstellung in Frankfurt zum Beispiel bin
ich von einem hochrangigen Finanz- und Bankkonsortium eingeladen
gewesen und dort waren sehr intelligente Leute dabei, von
denen mir ganz unumwunden gesagt worden ist, welches Interesse
sie an einem solchen Umgang haben. Informationen können sie
sich so leicht wie nie beschaffen und die sind selten widersprüchlich.
Kunst steht da außerhalb, sie stellt für sie die komplizierteste
Art der Informatik dar und, was entscheidend ist, eben die
widersprüchlichste. Am System der Kunst interessiert sie,
daß auseinanderstrebende sich absolut ausschließende Elemente
zu einem Ganzen werden, das im besten Fall so etwas wie Schönheit,
Harmonie oder schlicht Kraft hat. Das interessiert sie. Es
interessiert sie, wie es gelingt, divergierende Kräfte, völlig
freischwebende, kreuz- und querlaufende Informationen zu Einheiteb
zusammenzubringen, die funktionieren. Das ist also nicht bloßes
Kunstinteresse, das ist Systeminteresse. An diesem System
sind sie ganz egoistisch interessiert. Es beeindruckt sie,
daß man das alles am Objekt ganz konkret ablesen kann, der
Code des Kunstdenkens aber nicht zu knacken ist. Würde das
gelingen hätten sie den vielleicht kompliziertesten und interessantesten
Code in der Hand und das wäre ja sehr gefährlich. Das wird
aber keiner schaffen und damit erklärt sich die irritierende
Sicherheit der Kunst. In der Kunst kann nichts wiederholt
werden und es gibt auch für den, der eine Plastik gemacht
hat - der den Code intus hat - keine Möglichkeit, sie zu erklären.
Sonst würden ja alle Maler oder Bildhauer immer nur besser
werden.
Kunst kennt also keinen Fortschritt ?
Nein. Kunst hat im besten Fall nichteinmal eine Idee. Da
führt keine Evolution nach oben. Auch das steht den Systeminteressen
entgegen. Das ist die Chance der Kunst und zugleich der Grund
für die Unklarheit, wie es mit der Kunst oder den Museen weitergehen
kann.
|
|
Walter Pichler,
Bildhauer und Zeichner
geb. 1936 in Deutschnofen, Südtirol. Studium an der
Akademie für angewandte Kunst in Wien. Ausstellungen
u.a. in Wien, Kassel, Hamburg, New York, München, London,
Jerusalem, auf der Biennale in Venedig (1982) und im
Städelschen Kunstinstitut Frankfurt (1987). Großer Österreichischer
Staatspreis für bildende Kunst (1985)
|
|
|
Nachdruck als:
Walter Pichler im Gespräch mit Christian Reder
in:
Edelbert Köb / Kunsthaus Bregenz (Hg.):
Museumsarchitektur.
Texte und Projekte von Künstlern.
deutsch / englisch
Verlag der Buchhandlung Walter König, Köln
2000
mit Beiträgen vonGeorg Baselitz, Max Bill, Daniel
Buren, Heinrich Dunst, Helmut Federle, Katharina Fritsch,
Christoph Haerle, Marcia Hafif, Erwin Heerich, Gottfried
Honegger, Donald Judd, Per Kirkeby, Wolfgang Laib,
Markus Lüpertz, Gerhard Merz, François Morellet, Walter
Pichler, Richard Serra, Frank Stella, Bernar Venet,
Franz Erhard Walther, Peter Weibel, Peter Wigglesworth,
Rémy Zaugg und Heimo Zobernig
|
|