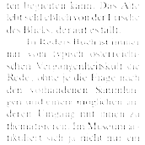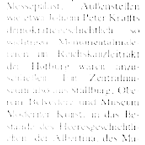|
Etwas in den Raum zu stellen, einfach so, als Gedanke, als
Bild, als Skizze, als Vorschlag, heißt, Impulsen zu folgen,
die nicht sofort wieder von Gegenargumenten blockiert und
umgeformt werden. Für Momente wenigstens wird Freiheit eingefordert.
Störungen sollen vorerst ausgesperrt bleiben, damit sich Assoziationen
entfalten können. Der Raum, um den es dabei geht, ist ein
fiktiver. Er muß nur leer sein, inhaltlich unbestimmt. Was
in ihm vor sich geht, dürfte in keine, Unzugehöriges aussondernde
Kategorien passen. Als vorurteilsfreier Raum bleibt er Theorie.
Trotzdem wird immer wieder versucht, ihn herzustellen, einfach
so, wenigstens als Gedankenspiel. Anders läßt sich Denken
gar nicht vorstellen. Schwierig wird es, sobald dieses Modell
auf einen konkreten Ort übertragen werden soll. Er dürfte
nichts Einengendes an sich haben, sollte aber zugleich abgeschirmt
sein. Um äußere Einflüsse fernzuhalten, braucht er Begrenzungen.
Intimität durch Transparenz zu ersetzen, kann zur Falle werden.
Das Vorbild von Zellen wird sich kaum vermeiden lassen. Gefängniszellen,
Klosterzellen, Meditationszellen, "white cubes" sind Grundmuster
für eine strikte Trennung von Innenwelt und Außenwelt. Das
Schweigen gehört dazu, als Äquivalent des Sehens, als Negation
des Wortes. Ort und Wort aber haben - als Zeichen- und als
Lautfolge - viel miteinander zu tun. Eines ist Teil des anderen.
Das den Unterschied ausmachende w verweist in erster Linie
auf Unsicherheiten: warum? - weshalb? - wieso? - wozu? / wer?
- was? - wann? - wie? - wo? / woher? - wohin? - womit? / wieviel?
Fragen über Fragen, die mit w beginnen. Daß die Bildung von
Bedeutungen nicht isoliert davon erfolgt, von wem, von wo
aus, in welcher Umgebung, etwas gesagt oder vorgeführt wird,
bindet auch in übertragenem Sinn das Wort an den Ort, an Positionen.
"Einfach in den Raum Gestelltes" macht, sobald es konkret
um Sachverhalte geht, dessen Begrenzungen erkennbar. Im jeweiligen
Resonanzraum sorgen Erwartungen für Ordnung. Schon aus statistischen
Gründen sind Überraschungen die Ausnahme. Etwas aus "seinem"
Umfeld herauszulösen, trennt es von mitschwingenden Bezügen.
Inwieweit das auch die auftauchenden Assoziationen verändert,
wird überprüfbar. Positionswechsel erleichtern manchmal ein
Wahrnehmen von Differenzen. Die ungewohnte Plazierung von
Aussagen, von Objekten, von Werken, wertet unter Umständen
die Rolle des Beobachters, der Beobachterin auf. Sie kann
Vieldeutigkeit sichtbarer machen, den Status in Frage stellen,
Einordnungen aufbrechen, Zusammenhänge verkomplizieren. Ein
gedachter, "vorurteilsfreier Raum" verwandelt sich in anderes.
Mit solchen Kategorien operiert das von Christoph Steinbrener
konzipierte "Unternehmen Capricorn", an dem sich eine Reihe
weiterer Künstler, wie der Dichter Ferdinand Schmatz, die
Medienkünstler Silvia Eckermann und Matthias Fuchs oder der
Musiker Christian Fennesz beteiligen. Von einer wissenschaftlichen
Denkweise aus werden künstlerische, visualisierende, akustische
Zugänge entwickelt. Als Ort für die temporäre Präsentation
von Sammlungsobjekten aus Wiener Museen wurde die Gegend um
den Karmelitermarkt gewählt, eine urbane Situation abseits
der Herzeigviertel. Distanz wird anders definiert als in musealen
Umgebungen. Zufällig verfügbare, gerade freistehende Geschäftslokale
werden zu unspektakulären Präsentationsräumen. Hinter den
Scheiben ist Ungewöhnliches zu sehen; wertvoll, im Sinn einer
kunsthistorischen Aura, sind nur wenige dieser Objekte. Zu
kaufen gibt es nichts, dafür scheinen die Dinge selbst etwas
zu sagen zu haben. Jemand muß sich dabei etwas gedacht haben.
Diesem Denken auf die Spur zu kommen, wird von der Straße
her möglich, der Blick in Auslagen genügt. Auf einer belebten
Geschäftsstraße ließe sich der Gedanke an eine mysteriöse
Werbeaktion nicht vermeiden. In dem nur verhalten an Konsum
orientierten Umfeld jedoch wird ein solcher Verdacht entkräftet,
denn einen unmittelbar einleuchtenden Zweck scheint die Aktion
nicht zu haben. Sie will aufmerksam machen, in genereller
und spezifischer Weise, durch ein wörtlich genommenes Entgegenkommen.
Daß es sich um Einsichten in Archive handelt, in denen Kostbares
und Merkwürdiges aufgehoben wird, ergibt sich erst aus den
Hinweisen auf die Herkunft: Sigmund Freud Museum, Jüdisches
Museum, Museum für Völkerkunde, Technisches Museum, Heeresgeschichtliches
Museum, Museum des 20. Jahrhunderts, Naturhistorisches Museum,
Museum für Volkskunde, Theatermuseum, Kunsthistorisches Museum,
Historisches Museum der Stadt Wien. Die kleinen Räume mit
den Exponaten lassen sich als Außenstationen begreifen, in
denen die Entschlüsselung komplexer Mitteilungen versucht
werden kann. Sie sind Nischen, Nischen im System des Sonstigen.
Ankunftsorte und Ausgangspunkte
Der Stadtraum, für den diese Infiltrierung alltäglicher Wirklichkeit
konzipiert wurde, ist das vom Karmeliter Markt, von der Hollandstraße,
der Leopoldsgasse, der Tandelmarktgasse und der Großen Sperlgasse
geprägte älteste Zentrum der Leopoldstadt, des 2. Wiener Gemeindebezirks.
Es ist eine gewöhnliche Gegend für einfache Leute, würden
die Stereotypien sagen. Sonderbarer Weise gehen sie davon
aus, daß Ungewöhnliches und Kompliziertes unter solchen Umständen
nicht zu erwarten ist. Einige der lange grau und schäbig gebliebenen
Häuser werden gerade renoviert. Jenseits des Eisernen Vorhangs
hat es oft sehr ähnlich ausgeschaut. Die sichtbar werdenden
Veränderungen folgen da und dort dem gleichen Rhythmus. Der
Karmelitermarkt gehört zu den beliebtesten Wiens. Warum sich
zwischen Augarten und Innenstadt, so nahe an der City, bisher
nicht mehr getan hat, würde jeden Immobilienmakler aus Frankfurt
verwundern. Geschichte macht sich auf den ersten Blick nirgends
bemerkbar, nur eine Art von Normalität, die anderswo keine
Chance mehr hat.
Von der Tradition als Bezirk der Ankunft ist manchmal wieder
etwas zu spüren; und auch davon, daß der massenhafte Zustrom
von früher schon die längste Zeit nicht mehr erwünscht ist.
Die Unterschiede sind offenbar so groß geworden, daß sie auf
keine "soziale" Akzeptanz mehr stoßen. Nur was ähnlich genug
ist, nach Aussehen, Sprache, Lohnniveau, wird halbwegs toleriert.
Das gelte genauso für Meinungen, heißt es an den diversen
Zynikertreffpunkten. Jede Abweichung, jede Aufgeregtheit über
die Zuspitzungen der Situation, entlarve Kritik als Selbstdarstellung.
Nur Distanz und Gelassenheit sei adäquat. Die Taten, nicht
die Worte seien zu bewerten, sagen inzwischen selbst viele
der Wortverwalter. Ein Lokalaugenschein vermittle bloß Scheinbares.
Um die Bedingungen für die Produktion von Ressentiments zu
studieren, genügt es wahrscheinlich auch, in Zeitungen zu
blättern, die vielleicht gerade in dieser Gegend in irgendeinem
Beisel noch länger herumliegen. Wer noch die letzten Weihnachtsnummern
mit Rückblicken auf das Basisjahr 00 aufstöbert, wird Aufrufe
zu Selbstverständlichem finden, die aus einer anderen Zeit
zu stammen scheinen; etwa diesen: "Wir wünschen in einem Land
und in einem gesellschaftlichen Klima zu leben, in dem Rückgriffe
auf die NS-Ideologie in der öffentlichen Debatte nicht verharmlost,
geduldet oder philosophisch cool betrachtet werden. Wir wissen
schon, dass man die Vergangenheit in dem Sinn nicht ‚bewältigen'
kann, aber wir meinen, dass man sich ihrer bewusst sein muss,
und das bedeutet, darüber zu sprechen." Die Zeitung, in der
das nachzulesen ist, heißt semantisch korrekt "Der Standard";
geäußert hat sich ihr besorgter Kolumnist Hans Rauscher, ein
deklariert wirtschaftsfreundlicher Neoliberaler. Auch in einem
anderen Blatt aus dem abgegriffenen Stapel wurde um diese
Zeit Besinnliches angesprochen, um mitzuhelfen, Standards
zu präzisieren. Die Frage, ob die Osterweiterung nach dem
Motto erfolgen müsse "Wer die Kriterien zuerst erfüllt, kommt
zuerst dran", beantwortet die Vizekanzlerin für "Die Presse"
knapp: "Ja, auf jeden Fall"; und der Bundesminister für Wirtschaft
und Arbeit teilt erfreut mit, daß "die jungen Menschen", selbst
in Österreich, "karriere- und marktorientierter als früher"
sind, denn "sie lassen sich nicht mehr so leicht auf Abwege
führen, die nur geistige, aber nicht materielle Erfüllung
bringen." Für oder gegen eine solche "materielle Erfüllung"
diesseits diverser Abwege zu polemisieren, könnte in der Gegend,
um die es hier geht, und angesichts ihrer Geschichte, nur
als weitere, bizarre Zuspitzung erfahren werden.
Denn als Zone für Zuwanderer, die rasch wieder weg wollten,
in bessere Gegenden in der Nähe oder sonst wo, oder die weg
mußten, weil es so angeordnet worden war, ist die Leopoldstadt
über Jahrhunderte hinweg ein exemplarischer Schauplatz gewesen,
exemplarisch als früheres Wiener Ghetto, exemplarisch für
die Exzesse der "Reichskristallnacht" zwischen dem 9. und
10. November 1938, in der, wie auch sonst in Wien, neben vielem
anderen alle der mehr als dreißig Leopoldstädter Synagogen
und Bethäuser zerstört worden sind, exemplarisch für die "Endlösung",
denn die Transporte in die Konzentrationslager sind vor allem
von den dort eingerichteten Sammellagern ausgegangen. Bedrohliches
verschiedener Intensität ist immer präsent gewesen. Schon
benannt ist dieser Bezirk, bis zur NS-Zeit kulturell von seiner
jüdischen Bevölkerung geprägt, nach einem ihrer erklärten
Feinde, dem Kaiser Leopold I., genauer gesagt nach seinem
Namenspatron, dem Heiligen Leopold, der in dessen Regierungszeit
Landespatron Österreichs wurde. Um dieser alten Vorstadt ein
Zentrum zu geben, ist 1623-27, während des Dreißigjährigen
Krieges, in einer Intensivphase der Gegenreformation, die
Karmeliterkirche, ursprünglich mit angeschlossenem Kloster,
gebaut worden, von der sich die Bezeichnung des Marktes herleitet.
Damals durften nur noch Katholiken Bürger Wiens sein. Protestanten
gab es keine mehr. Alle Juden mußten die Stadt verlassen;
außerhalb von ihr, ausgerechnet neben dem neuen Gotteshaus,
ist ihnen der Platz für das künftige Ghetto zugewiesen worden.
Es lag im von Karmeliterkirche, Taborstraße, Augarten und
heutiger Malzgasse, Großer Schiffgasse und Krummbaumgasse
begrenzten Gebiet. Seine Hauptstraße verlief etwa so wie die
Große Sperlgasse. Auf 132 Häuser angewachsen, ist das Ghetto
schon 1670, im Zuge der zweiten großen Vertreibung nach 1420
(vor der sich jüdische Bewohner Wiens rund um den heutigen
Judenplatz ansiedeln mußten), wieder aufgelöst worden. An
Stelle der unverzüglich abgerissenen Synagoge wurde eine zweite,
Leopold geweihte Kirche gebaut, die dem Viertel seinen Namen
gab. An der Grundsteinlegung hat der Kaiser persönlich teilgenommen.
Seine inquisitionsgewohnte Frau, die spanische Infantin Margarita
Teresa, war eine treibende Kraft dieser Reinigungs- und Aussonderungsinitiativen.
Während der Türkenbelagerung zerstört, ist die Leopoldskirche
neu errichtet worden; über ihrem Haupteingang hält ein in
Stein gemeißelter Text bis heute fest, daß dort ursprünglich
eine Synagoge gestanden hat.
Eine andere Art, Geschichte präsent zu halten, wird vor dem
Haus Leopoldsgasse 29 demonstriert. Die 1990 von der Stadt
Wien angebrachte Gedenktafel für die 1938 niedergebrannte
"Polnische Synagoge", mußte auf einer von der Wand abgesetzten
Stange angebracht werden, da die Hauseigentümer offenbar keine
Genehmigung dafür gegeben haben, trotz der aus der "Neuen
Wiener Wohnbauaktion 1958" bezogenen öffentlichen Mittel,
wie das pflichtgemäß auf einem weiteren Schild vermerkt ist.
Sie ist auch als "Polnische Schul" bezeichnet worden, so wie
die "Schiffschul" in der Großen Schiffgasse 8, an die seit
1988 eine Tafel erinnert. Die öffentliche, inzwischen nach
Friedrich Kiesler (zugewandert aus Czernowitz), der u. a.
den "Schrein des Buches" in Jerusalem entworfen hat, benannte
Schule in der Kleinen Sperlgasse 2a wiederum, ist eine der
Sammelstellen für den Abtransport in die Konzentrationslager
gewesen. Seit 1984 wird das mit einer Aufschrift dokumentiert.
In der Schiffamtsgasse 1 stand das Bezirksgefängnis, Durchgangsstation
für viele politisch Verfolgte. Eine Tafel am Marktamt würdigt
den im KZ Mauthausen umgekommenen Spanienkämpfer Alfred Ochshorn.
Ein paar Straßen weiter, in der Förstergasse 7, wird an das
Massaker abziehender SS-Verbände erinnert, dem noch am 12.
April 1945 neun, bis dahin versteckte "rassisch Minderwertige"
zum Opfer gefallen sind. In der behelfsmäßigen Gestaltung
solcher Texttafeln drückt sich aus, daß auch Hinweise auf
"das Leid der Opfer der menschfabrizierten Apokalypse" (Agnes
Heller) nur wie hilflose, provisorische Reaktionen wirken
können. Sie manchmal wahrzunehmen, als Blickpunkte für Passanten,
spiegelt wenigstens das Alltägliche, von dem der Terror ausgegangen
ist.
Wie "modellhaft" gerade in Wien das antisemitische Programm
umgesetzt wurde, hat sich nicht nur im unmittelbar einsetzenden
Terror gezeigt, der anfangs massiver und bedingungsloser gewesen
ist als selbst in Berlin, sondern auch in der Symbolik der
Dramaturgie. Die Mitten in der Leopoldstadt gelegene Nordwestbahnhalle,
deren Bombenruine nach dem Krieg abgerissen wurde (Taborstraße
89-93), ist zum Zentrum der Kundgebungen für die Volksabstimmung
zum Anschluß gemacht worden. Hitler hat dort am 9. April 1938
seine große Rede dazu gehalten. Anschließend wurde in ihr
die Propaganda-Ausstellung "Der ewige Jude" gezeigt. Schon
seit März 1938 lagen Stadtplanungen aus dem Büro von Albert
Speer vor, die Wien mit drastischen Eingriffen an die Donau
rücken sollten, unter fast völliger Eliminierung des Baubestandes
im 2. Bezirk. Eine 1941 von Reichsarchitekt Hanns Dustmann
vorgelegte Variante verlängerte die Ringstraße über die Donau.
Innerhalb dieses Gebietes sollte es zu einer imperialen Neubebauung
kommen, mit einer Achse hin zu einem Monumentalbau im Gebiet
der heutigen Donaucity. Dessen Gegenstück hätten ein weiteres
Großmonument in der Gegend des Karmelitermarktes bilden sollen.
Der Bezirk der Ankunft sollte spurlos verschwinden, jenes
dichte Gebiet jüdischer Traditionen, in dem so viel begonnen
hat. An der Ecke zum Donaukanal hin (heute Hollandstraße 1),
hat Theodor Herzl eine Zeitlang gewohnt, direkt gegenüber
der Geburtshäuser von Hermann Broch und Martin Buber (Franz
Josefs-Kai 37 und 45), sowie des Hotel "Metropol" nebenan,
das zum Gestapohauptquartier werden sollte. Ebenfalls am Wasser,
Obere Donaustraße 5, wurde Arnold Schönberg geboren. Sigmund
Freud ist als Kind, aus Mähren kommend, mit seiner Familie
in die Pfeffergasse 1 gezogen und hat das Gymnasium in der
Taborstraße 24 besucht. Die berühmte Wohnung in der Berggasse
19, im nobleren Viertel gleich über dem Fluß, konnte er sich
erst ab 1891 leisten. Arthur Schnitzlers Geburtshaus hat die
Adresse Praterstraße 16. Seine Großeltern und "die meisten
anderen Verwandten wohnten ganz in der Nähe", berichtet er
in seiner Autobiographie "Jugend in Wien"; der damals, "in
der Spätblüte des Liberalismus", spürbare Antisemtismus sei
noch erträglich gewesen, heißt es dort, er existierte zwar,
"wie seit jeher, als Gefühlsregung in zahlreichen, dazu disponierten
Seelen und als höchst entwicklungsfähige Idee; aber weder
als politischer noch als sozialer Faktor spielte er eine bedeutende
Rolle." Elias Canetti hat als Kind, aus Bulgarien kommend,
nach Aufenthalten in Manchester und der Schweiz, anfangs in
der Josef Gall-Gasse 5, direkt am Prater gewohnt und ist dort
zur Schule gegangen. Als Student hatte er zuerst ein Untermietzimmer
in der Praterstraße 22; seine spätere Frau Veza hat nicht
weit davon, in der Ferdinandstraße gewohnt. Das Geburtshaus
von Otto Bauer hat die Adresse Leopoldsgasse 6-8. Ein paar
Häuser weiter, Leopoldsgasse 13-15, zeitweilig auch ein Sammellager
zum Abtransport in die KZs, steht heute der Theodor Herzl-Hof.
In der Heinestraße 4 ist die letzte Wohnung Jura Soyfers gewesen,
der in Buchenwald umgekommen ist. Im Haus Heinestraße 27 wurde
die Kernphysikerin Lise Meitner geboren, die rechtzeitig nach
Schweden fliehen konnte. In der Pazmanitengasse 6 stand der
Pazmanitentempel. Die von Canetti zusätzlich besuchte Talmud-Thora-Schule
war in der Novaragasse 27. Im Haus Cerningasse 6 lebte der
Neurologe und Psychiater Viktor E. Frankl, der das KZ überlebt
hat. Die Wohn- und Wirkungsstätten Alfred Adlers, des Begründers
der Individualpsychologie, waren die Häuser Cerningasse 7
und Dominikanerbastei 10. Von ihm stammt der viele Motive
erhellende Begriff "Minderwertigkeitskomplex"; 1932 ist er
in die USA emigriert. Die Schule in der Vereinsgasse 21 erinnert
seit 1989 an die 64 unmittelbar nach dem Anschluß von ihr
verwiesenen jüdischen Schüler und Schülerinnen. Auf den früheren
Standort des "Türkischen Tempels" der lange unter osmanischem
Schutz stehenden Sephardischen Gemeinde in der Zirkusgasse
22 weist seit 1988 ein Schild hin. An Stelle des "Leopoldstädter
Tempels", Tempelgasse 3-5, steht heute wieder ein jüdisches
Zentrum. Wie die anderen wiederbelebten jüdischen Einrichtungen
in der Gegend muß es ständig bewacht werden. Auf engstem Raum
kreuzen sich Linien, Spuren. Auftauchende Namen aber sind
nur Punkte in einem Raster der Vorgänge, in denen es ausdrücklich
um Anonymität, um die Masse, und um die Masse der Opfer gegangen
ist. Gedenktafeln symbolisieren auch ein Warten darauf, daß
sie beachtet werden. Wann sie jeweils angebracht worden sind,
läßt einen Rhythmus in der öffentlichen Aufmerksamkeit erkennen.
Zur bis 1938 existierenden Atmosphäre dieses Bezirks, in dem
das Zentrum unmittelbar in Peripherie übergeht, hat Ruth Beckermann
ein gültig bleibendes Buch herausgebracht: "Die Mazzesinsel";
Stephen Beller etwa zeichnet den jüdischen Einfluß auf die
umfassende kulturelle Innovation dieser Zeit nach ("Wien und
die Juden. 1867-1938"). Daß Johann Strauß ausgerechnet in
der Leopoldstadt, im Haus Praterstraße 54, "An der schönen
blauen Donau" komponiert hat, wirkt wie ein Zufall, der sich
erst Zug um Zug als Teil einer ins Unvorstellbare kippenden
Konstellation zu erkennen geben wollte.
Die Stadt als Archiv
Das "Unternehmen Capricorn" versucht, in indirekter Weise
auf solche geschichtlichen, stadträumlichen, in der Gegenwart
fortwirkenden Überlagerungen zu reagieren. Zur Geschichte
selbst sind nur Andeutungen möglich, schon um nicht neuerlich
Opfer zu Objekten zu machen. Indem die künstlerischen Interventionen
Freuds "Traum von der botanischen Monographie" aufgreifen,
in dessen Analyse er von "Gedankenverbindungen" und "Knotenpunkten"
spricht und davon, wie "überdeterminiert" und "vieldeutig"
im Traum zusammentreffende Inhalte sind, wie ein Buch oder
Blumen, wird Alltägliches mit Ausuferndem verbunden. Die Zyklame
vor allem, die Lieblingsblume seiner Frau, ließe sich auch
in den umliegenden Wohnungen finden. Dem zerstörten Jüdischen
Museum in der Malzgasse 16 hingegen, das erst nach einem halben
Jahrhundert in der Dorotheergasse wieder geeignete Räume bekam,
wird schlicht ein Eindruck von Leere gewidmet. Eine nachgebaute
russische Wachstube reflektiert die Umstände der Befreiung
und die düstere, selbst familienintern von Schweigen und neuerlicher
Feindseligkeit geprägte Atmosphäre der Nachkriegszeit.
Der Devotionalienkult hat eine eigene Kammer, so wie die
Kunstpädagogik. Franz Cizek, der in seinen kunstpädagogischen
Konzepten und berühmten "Kursen für Jugendkunst" an der Wiener
Kunstgewerbeschule in Lehrern bloß unvoreingenommene Beobachter
sehen wollte, wird mit eigenen Arbeiten und solchen von Schülern
und Schülerinnen präsentiert, als Reminiszenz an seine, trotz
Emigration ungebrochene internationale Wirkung. Auf die kriegsähnlichen
Facetten der Industrialisierung - neben der rechtlichen Gleichstellung
jüdischer Bürger ab 1867, den Pogromen in Rußland, den Flüchtlingsströmen
nach 1915 - Auslöser für die Zuwanderungswellen nach Wien,
verweisen "gewerbehygienische" Prothesen und Relikte abgestorbener
Gewerbe. Guillaume Bijls fiktives Sterbezimmer für einen fiktiven
Komponisten ironisiert den Umgang mit Prominenz, als den Stellvertretern
eigener Sehnsüchte. Ein riesiger Fisch aus der Donau spielt
auf deren früheren Artenreichtum an, vielleicht auch auf den
bis in die 1960er Jahre bestehenden Fischmarkt an der Salztorbrücke.
Daß es die Dritte Welt nicht mehr gibt, seit die Zweite Welt
ihre Sonderstellung aufgeben mußte, machen Vitrinen mit exotischen
Objekten deutlich. Sie stammen durchwegs aus armen Ländern
des Südens, deren reichen Kulturen bestenfalls noch ein verschüttetes
Potential zugebilligt wird. Ohne ihre strukturellen Schwächen
würden sie tendenziell als gefährlich betrachtet werden.
Für gewöhnlich Verborgenes, das nur selten die Archive verläßt,
in Außenstationen zur Geltung und in veränderte Zusammenhänge
zu bringen, kann den Stadtraum mit Fragen stellenden Irritationen
aufladen. Das Vorübergehende daran bietet Vorübergehenden
eine Zeitlang die Möglichkeit anderer Einsichten. Sie werden
ernst genommen. Es wird eben nicht "einfach etwas in den Raum
gestellt", sondern aus Fragmenten ein Netz gebildet, das für
Erinnerungen und Perspektiven Anhaltspunkte liefert. Daß die
Reaktionen unberechenbar bleiben, also nicht nach vorausbestimmten
Mustern ablaufen dürften, ergibt Differenzen zum geschäftigen,
wie auch zum musealen Alltag. Ein Hinausgehen aus "geschützten
Werkstätten", die im Fall der Museen kaum noch "geschützt"
sind und erst "Werkstätten" werden müßten, stellt sich gegen
die Automatik, von der Kunst und historische Artefakte zur
bloßen Erinnerung an frühere geistige Leistungen gemacht werden.
Es stellt sich aber auch gegen differenzlose Privatisierungsstrategien,
weil es in diesem Fall aus künstlerischer Eigeninitiative,
die als öffentlicher Dienst zu verstehen ist, stattfindet.
Musealisierung als solche wird zum Thema, nicht nur, weil
die gewählte Gegend, bezogen auf die Innenstadt, dem Museumsbezirk
und seinem Hang zum Repräsentativen genau gegenüber liegt.
Interventionen dieser Art versuchen, den üblichen Interventionen
etwas entgegenzusetzen, als Exempel dafür, wie die Zusammenarbeit
von Künstlern und Wissenschaftlern bei "normaler" Nachfrage
funktionieren könnte. Daß selbst starr gefügte Institutionen
zu einer Mitwirkung überredet werden konnten, demonstriert,
daß es intern durchaus ein Interesse an experimentellen Vorhaben
gäbe. Zu leistungsfähigen "Plattformen für interessante Projekte"
aber, die eine Bedeutungsbildung in Fluß halten, durften die
Museen hierzulande nicht werden. Kaum eines von ihnen konnte
über Forschung, über Publikationen oder wirklich wegweisende
Ausstellungen an Profil gewinnen. Die Museumskultur Mexikos
etwa hat sich auf das Bewußtsein um Bedeutungen viel tiefgreifender
ausgewirkt. Gezehrt wird von dem, was da ist und was ausgeborgt
werden kann. Der Nachholbedarf an Klassik wurde bestimmend,
nach dem Schema Klimt bis Picasso, so als ob ein rückständiges
Publikum erst in die Moderne eingeführt werden müßte. Als
Modell ist das veränderungsfreudige MAK (das Museum für angewandte
Kunst) vom "Kunstforum Bank Austria" abgelöst worden. Es funktioniert
privat; die große Bank führt vor, daß sie für Riskantes nicht
so ohne weiteres Kredit gibt. Statt Innovation wird Sicherheit
signalisiert; allerdings im Sinn einer Hypothek. Das große
Haus für Kunsthistorisches brachte Henry Moore und auffallend
viele Sachen über Gold und Preziosen. Inhaltliche Abgrenzungen
zwischen den einzelnen Institutionen haben sich weitgehend
aufgelöst. Trotz aller Neu- und Umbauten gäbe es gute Gründe,
von Investitionsruinen, die ziellos Milliardenwerte beherbergen,
zu reden. Mit eingefrorenen Budgets transformiert sich öffentliches
Interesse zu dem was sich rechnet. Die Bewegung hat ein Ziel
bekommen: den Sponsor. Die wenigen dafür in Frage kommenden
Geldgeber sollen dafür sorgen, daß außertourlich überhaupt
etwas stattfinden kann. Der einzige Großsammler österreichischer
Jahrhundertwende-Klassik hat im Museumsquartier sein eigenes
Haus erhalten, gleich neben dem stillen Museum Moderner Kunst;
dort darf er schalten und walten wie er will, auf Steuermittelbasis
natürlich. Zwanzig Jahre Museumsreform kulminieren in diesen
Bauten. Anderes ist unter den gegebenen Umständen offenbar
nicht möglich gewesen: Ein fast schwarzer Bau rechts, ein
weißer links, und dazwischen ein Denkmalschutzobjekt. Ringsum
soll eine Mischung aus Shops und einigen laborartigen Einrichtungen
entstehen, damit heute Nötiges zentral verfügbar ist. Wenigstens
die dunklen Machinationen mit in der NS-Zeit geraubten, in
Staatsbesitz gelangten Kunstwerken kommen, unter Druck, inzwischen
ans Licht. Daß sich die Bundesmuseen, nach dem Muster "Unternehmen
Österreich", in Richtung Museumskonzern entwickeln, in dem
Enklaven für Eigensinniges kaum noch Platz haben, ist absehbar.
Was in öffentlichem Interesse geschieht, welcher Grad an Buntheit,
an Aufmerksamkeit erreicht wird, bleibt ohnedies privaten
gesellschaftlichen Kräftekonstellationen überlassen, neben
denen Offizielles, je nach der eigenen Position, fast immer
alt ausschaut. Laut Boris Groys, dem neuen Rektor der Akademie
der bildenden Künste, verschieben sich einfach die Pragmatismusbedingungen.
In einer Welt, die weder verstanden noch verändert werden
könne, gebe es "am Ende des musealen Zeitalters" nur eine
Perspektive: "Das einzige was man tun kann, ist die Welt zu
sammeln. Die metaphysische, religiöse oder ideologische Grundfrage
von damals, nämlich die Frage ‚Was bleibt?', ist zu einem
technischen Problem des musealen Sammelns und Aufbewahrens
geworden. Wir sind, was wir sammeln." Sein Nachdenken über
"das Neue" und die Vermittlungsarbeit haben ihm bereits negative
Kulturglossen eingetragen. Mit einer solchen Auffassung würde
er nicht dazupassen, heißt es, denn ab jetzt gehe es direkt
um die Förderung der Produktiven. Die "Apparate" brauche kaum
wer. Neue Strukturen müßten von selbst entstehen; marktkonform.
Wenn sich die öffentliche Hand noch einmischt, dann zur Minimalvorsorge
und als Mäzen, also gnadenhalber und um sich zu schmücken.
Von inhaltlichen Vorstellungen, Rechtsansprüchen, normalen
Arbeitsmöglichkeiten und anderen Selbstverständlichkeiten
ist kaum die Rede, obwohl die Begeisterung für eine "Kulturgesellschaft",
eine "Wissensgesellschaft", eine "Dienstleistungsgesellschaft",
fast der politisch so beliebten "Management"-, "High Tech"-
und "Synergie"-Euphorie entspricht. An den Schlüsselpositionen
läßt sich ablesen, wie ernst die Verpflichtung zu internationalen
Ausschreibungen genommen wird. Offenbar ist allgemein bewußt,
daß Fremde, die sich mit den lokalen Feinheiten nicht auskennen,
in solchen Funktionen ohnedies chancenlos wären. Daß ein Museum
für zeitgenössische Geschichte, ob als "Haus der Toleranz"
oder nicht, derzeit wenig Realisierungschancen hat, dürfte
angesichts der herrschenden Stimmungskoalitionen ein Glück
sein. Es käme nicht darum herum, sich mit so aktuellen Themen
wie "Patriotismus" und "Vaterlandsverrat" zu beschäftigen,
mit dem auflebenden Sprachgebrauch der 1950er Jahre also,
mit den "roten Brüdern" oder der weiterhin stilbildenden "Stephansplatzrede"
des Koalitionsdirigenten aus Kärnten (deren lehrreiches Videoband
zum Staatsgeheimnis geworden ist, aber gut als Einstimmung
passen würde). Mit bloß musealer Definitionsmacht jedoch läßt
sich nicht verdeutlichen, ob, woran und warum die Geister
sich überhaupt noch scheiden.
Die Stadt selbst wenigstens ist schon für sich genommen ein
weites, Wissen speicherndes Feld für eine Spurensuche, für
ein Nachfragen. Das einzige neue Wiener Großprojekt, das wirklich
Austauschprozessen dient, ist die U-Bahn geblieben; sie bringt
viele Leute rasch woanders hin. Nur der Flughafenanschluß
fehlt noch. Die virtuellen Parallelen dazu, das Satellitenfernsehen,
das Internet, haben sich von selbst ergeben. Solche Strukturen
bieten einem Warten, Schauen, Lesen, Hören, Treffen, Einsteigen,
Umsteigen, Aussteigen wenigstens Fluchtmöglichkeiten in internationale
Sphären. Wer es darauf anlegt, kann sich auch innerhalb dieser
Systeme absondern und Fremdes erkunden. Auf Archive verweisende
Schaufenster sind Versuche, für solche Eigensinnigkeiten gedachte
Linien zu legen. Von Nischen im System des Sonstigen aus,
wird auf mögliche Verbindungen zwischen Einzelheiten aufmerksam
gemacht, ohne daß solche Ansätze ein produktives Weiterdenken
gleich wieder in vorgefertigte Bahnen lenken. In Georg Francks
"Ökonomie der Aufmerksamkeit" heißt es dazu: "Wissenschaft
ist die systematisch veranstaltete, professionell betriebene
und arbeitsteilig organisierte Befriedigung von Neugier. Aber
nicht nur. Der Wissenschaftsbetrieb ist auch eine im industriellen
Maßstab organisierte Ökonomie der Wissen produzierenden Aufmerksamkeit.
Die wichtigsten Produktionsmittel der Wissenschaft sind vorproduziertes
Wissen und lebendige Aufmerksamkeit." In welchem Ausmaß gegen
unpassende Arten von Aufmerksamkeit Stimmung gemacht und Irritationen
als Erfindung, als etwas Künstliches abgetan werden, charakterisiert,
was jeweils unter Offenheit gemeint ist. Auf Österreich bezogen
geht es in dieser Hinsicht plötzlich wieder um Größe, wenn
der für die regionale Klimaverschärfung zuständige Taktik-Kanzler
davon spricht, es gehöre eben Größe dazu, "sich auf das Wesentliche
zu konzentrieren und verschiedene Störungen und Nebengeräusche
auszublenden." Wenn auch bloß auf Wörter wie "Wende" bezogen,
liefert er plötzlich kategorische Aussagen, die einem erst
einfallen müssen: "Mich stört prinzipiell jeder Import von
woanders."
|
 Das Wiener Ghetto um 1670.
Das Wiener Ghetto um 1670.
Aus: Pierre Genée: Wiener Synagogen 1825-1938.
Löcker Verlag, Wien 1987. S. 20 |

Tafel über dem Hauptportal der Leopoldskirche
mit Hinweis auf die frühere Synagoge an diesem
Ort |
 Gedenktafel "Polnische Synagoge",
Wien 2., Leopoldsgasse 29
Gedenktafel "Polnische Synagoge",
Wien 2., Leopoldsgasse 29 |
 Hitler-Rede in der Halle des Nordwestbahnhofs
zum Abschluß des "Kampfes für die Volksabstimmung
in Österreich", 9. April 1938. Aus: Wien 1938.
Historisches Museum der Stadt Wien, Wien
Hitler-Rede in der Halle des Nordwestbahnhofs
zum Abschluß des "Kampfes für die Volksabstimmung
in Österreich", 9. April 1938. Aus: Wien 1938.
Historisches Museum der Stadt Wien, Wien
|
 Propaganda-Ausstellung in der Halle
des Nordwestbahnhofs, 1938. Aus: Stadtchronik Wien.
Wien
Propaganda-Ausstellung in der Halle
des Nordwestbahnhofs, 1938. Aus: Stadtchronik Wien.
Wien |
 Hanns Dustmann: Neugestaltungsentwurf
Wien, 1941. Aus: Wien 1938. Historisches Museum der
Stadt Wien, Wien
Hanns Dustmann: Neugestaltungsentwurf
Wien, 1941. Aus: Wien 1938. Historisches Museum der
Stadt Wien, Wien |
 Ruth Beckermann (Hg.): Die Mazzesinsel.
Juden in der Wiener Leopoldstadt 1918 - 1938. Wien 1984
Ruth Beckermann (Hg.): Die Mazzesinsel.
Juden in der Wiener Leopoldstadt 1918 - 1938. Wien 1984 |
 Plakat, 1946. Heeresgeschichtliches
Museum Wien
Plakat, 1946. Heeresgeschichtliches
Museum Wien |
 Flugzeuge, Kinderspielzeug. Pakistan,
1990. Museum für Völkerkunde Wien
Flugzeuge, Kinderspielzeug. Pakistan,
1990. Museum für Völkerkunde Wien |

Boris Groys: Logik der Sammlung. Am Ende des musealen
Zeitalters. München - Wien 1997 |

Agnes Heller: Requiem für ein Jahrhundert. Hamburg
1995. Angesichts unseres Jahrhunderts. Reden über
Gewalt und Destruktivität Heft 4. Hamburg 1995 |

Georg Franck: Ökonomie der Aufmerksamkeit. München
- Wien 1998 |
|