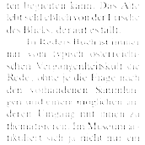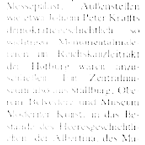| Ein
vorsichtig-skeptischer Denker wie Karl Popper (1902
-1994), der gegenüber jedem zu Totalitärem
neigenden Utopismus höchst misstrauisch gewesen
ist (1), hat
bis zuletzt immer wieder davon gesprochen, dass gerade
Grundschulen höchste Qualität und Zuwendung
bieten müssten, weil frühe Weichenstellungen
und Förderungen entscheidend seien. Wegen der erforderlichen
Intensität sollten deren Lehrer und Lehrerinnen
mindestens so viel verdienen wie jene an Gymnasien oder
Universitäten; bei schwindendem Engagement wäre
es vernünftig, ein Umsteigen in andere Berufe zu
erleichtern. Auf solche dem Lauf der Dinge konträre
Vorstellungen hat zum Beispiel auch Hans Magnus Enzensberger
in seinem „Plädoyer für den Hauslehrer"
(1982) gesetzt, als er eine weit gehende Auflösung
von Schulgebäuden und flexibel einsetzbare Budgets
für einen vagabundierenden freien Projektunterricht
in sich da und dort, in Wohnungen, Parks, Museen, Cafés
zusammenfindenden Kleingruppen propagierte. (2)
Symptomatisch jedoch wurde dahinfließende Routine.
Denn selbst in immer reicher gewordenen Ländern
versanden wegen verfilzt-ausbalancierter Schulbürokratien
(inklusive fest gefügter Schulbuchkartelle) ständig
Initiativen, die Ausbildungsangebote und damit das offerierte
Ausprägen von Lebensvorstellungen immer wieder
von Grund auf neu zu überdenken und einschneidende
Alternativen anzusteuern. Ansätze zu fächerübergreifender
Projektarbeit, Personal Computer, Internet-Hoffnungen
und eine ostentativ sparsame Schäbigkeit des öffentlichen
Sektors scheinen als Restperspektiven zu genügen.
Demgegenüber sind gerade die legendären russischen
Aufbruchszeiten trotz des damaligen Chaos, der Armut,
diffuser Hoffnungen, ganz anderer Bedürfnisse,
der schließlich erbarmungslos kanalisierten, aber
auch von Selbstzensur umgepolten Ideenvielfalt höchst
signifikant für Vorstellungen von radikaler Moderne
geworden. Deren Relikte, und Bücher für Kinder
sollten so ernst genommen werden wie andere wichtige
Projekte, können bewusst machen, was kulturell
unter schwierigsten Umständen in kurzer Zeit möglich
wurde und welchen Transformationen dies schließlich
unterlegen ist. Manches an der Ausgangssituation entspricht
ärmlich-devastierten Zuständen, wie sie nach
wie vor in weiten Teilen der Welt herrschen, ob in Odessa,
Kalkutta, Kairo, Belgrad oder Brooklyn. Sich Damaliges
zu vergegenwärtigen, ist auch nach Auflösung
der offiziellen Ost-West-Polarisierung nicht zuletzt
wegen der gegenseitig nachwirkenden jahrzehntelangen
Propaganda des Kalten Krieges nur über Versuche
partieller Rekonstruktionen möglich.
Wird dabei einem Russlandkenner wie Boris Groys und
seinen detailreichen Kulturanalysen gefolgt, lässt
sich die dortige Entwicklung erst plausibel interpretieren,
wenn die in manchem so glorreichen Anfangszeiten nicht
heroisiert, sondern „das künstlerische Projekt
der Zeit vor Stalin und die Stalinzeit, nämlich
der Aufbau eines neuen Lebens, und gleichzeitig das
künstlerische Projekt der Gegenwart, das Projekt
der Reflexion dieses Experiments“, in die Betrachtungen
einbezogen werden. Landläufige Auffassungen von
einem radikalen Bruch würden nur den „Mythos
von der Unschuld der Avantgarde" bestärken,
diese vom tatsächlichen historischen Prozess isolieren.
„Von der Darstellung der Welt zu ihrer Umgestaltung
fortzuschreiten", also der „Traum der Avantgarde,
das gesamte gesellschaftliche Leben nach einem künstlerischen
Gesamtplan zu organisieren", sei nämlich für
die maßgeblichen, noch experimentell denkenden
Kräfte um 1920, genauso aber für die stringent
systematisierten Phasen danach das bestimmende Moment
gewesen, wenn auch mit völlig anderen als den ursprünglich
beabsichtigten Ergebnissen. (3)
Mit der MAK-Ausstellung „Schili-Byli" –
„Es war einmal" –, die Bücher
und Zeitschriften für Kinder präsentiert,
die vor allem während der ersten Jahrzehnte des
20. Jahrhunderts in der Sowjetunion entstanden, wird
daher auch nicht bloß auf Märchen angespielt;
es schwingt entschieden mit, dass Märchen wahr
werden sollten – genauso aber, dass sie nicht
unbedingt gut enden müssen.
In der 1920 von EI Lissitzky (1890-1941) konzipierten,
mit sehr wenig Wörtern auskommenden „Suprematistischen
Erzählung von zwei Quadraten. In 6 Konstruktionen"
zum Beispiel – aufbewahrt in der MAK-Bibliothek
und Kunstblättersammlung – fliegen ein schwarzes
und ein rotes Quadrat aus dem Weltraum auf die Erde,
um eine neue Ordnung zu errichten. Das Ringen um die
beste Lösung endet nach zwanzig Seiten mit dem
Verschwinden des schwarzen Quadrats; das rote bleibt
übrig, als Basis für Künftiges. Die Bauanleitung
zur Neukonstruktion besteht aus der schlichten Botschaft
„weiter" – als Ausdruck der Utopie
ununterbrochener Bewegung. Gut und Böse wird Kindern
über eine feinsinnig aufgelöste geometrisch-abstrahierende
Formensprache nahe gebracht, die jede Personifizierung
ausspart, vieles offen lässt. Religiöse Dualismen
bleiben latent, wenden sich aber offensiv ins Diesseits.
Das berühmte „Schwarze Quadrat" von
Malewitsch (1913/1915) ruht nicht mehr kontemplativ
in sich selbst, sondern wird Teil einer Handlung. Dessen
knappe sprachliche Formel dafür lautet: „Das
Quadrat = die Empfindung, das weiße Feld = das
,Nichts' außerhalb dieser Empfindung." (4)
EI Lissitzkys Anknüpfen daran ist so offensichtlich
wie Bezüge zu seinem früheren Bemühen
um ein Neubeleben säkularer jüdischer Kultur,
das er ebenfalls über von ihm gestaltete Kinderbücher
forcieren wollte. Mit gänzlich neuen Zeichen, mit
einem völlig neuen „Alphabet" Voraussetzungen
für das Neubauen der Welt zu schaffen, wurde in
den Intensivphasen dieser Prozesse zur bestimmenden,
fixen Idee, mit dem Alten und Neuen Testament, dem Kommunistischen
Manifest – als Zwischenstufen – und dem
„Suprematismus" von Malewitsch als Finalstadium,
als eine Zukunft jenseits des menschlichen Denkvermögens,
in der erst universelle Energien für eine umfassende
Lebensgestaltung als solche freigesetzt werden könnten
(Supremus = der Höchste; „Suprematismus -
Die gegenstandslose Welt", 1922). (5)
„Der Avantgarde selbst war die sakrale Bedeutung
ihrer Praxis voll bewusst", konstatiert Boris Groys
dazu, ist doch das „Schwarze Quadrat" erstmals
in einem kollektiv verfassten futuristischen Mysterienspiel
(„Sieg über die Sonne", 1913) aufgetaucht,
das „die künstliche Sonne einer neuen Kultur,
einer neuen technischen Welt" thematisiert. (6)
Entscheidend für die vorübergehende Radikalisierung
EI Lissitzkys, von seiner Ausbildung in Darmstadt her
Architekt, war die kurze Zusammenarbeit mit Malewitsch
an der „für alle" gedachten Kunstschule
von Witebsk, die Marc Chagall, der wenig von deren Bestrebungen
hielt, sie aber zuließ, als für die Region
zuständiger Kulturkommissar in seiner Heimatstadt
gegründet hatte. Die entwickelten Bildvorstellungen
auf Räume und mehrdimensionale Realitäten
auszudehnen und bereits Kindern ein Denken in den avanciertesten
Kategorien der Zeit nahe zu bringen, war Ausdruck dieses
vieles ausschließenden Maximalismus; nur artikulierten
sich gleichzeitig bereits massive, alle „Unabhängigen",
genauso aber sich exponierende „linke Künstler"
zunehmend ausgrenzende Gegenströmungen, von denen
eine proletarische Orientierung auf konkrete Gestaltungsaufgaben
in der Produktion und allgemein verständliche Bilder
für nützlicher gehalten wurden.
Vladimir Nabokov (1899-1977), aufgewachsen in einem
als „reichhaltig und intensiv" empfundenen
gebildeten Umfeld in St. Petersburg, hat von Anfang
an nicht an die propagierten Möglichkeiten geglaubt;
die gesamte Familie emigrierte 1919. „Mit ganz
wenigen Ausnahmen", schreibt er in „Erinnerung,
sprich", „hatten alle liberal gesinnten schöpferischen
Kräfte – Lyriker, Romanciers, Kritiker, Historiker,
Philosophen und so weiter – Lenins und Stalins
Russland verlassen. Die geblieben waren, kümmerten
entweder dahin oder ruinierten ihr Talent, indem sie
sich den politischen Forderungen des Staates fügten.
Was den Zaren niemals gelungen war, nämlich die
Geister völlig an die Kandare zu legen und dem
Willen der Regierung gefügig zu machen, erreichten
die Bolschewisten in kürzester Frist, nachdem die
Hauptmasse der Intellektuellen ins Ausland geflohen
oder liquidiert war." (7)
Auch unter jenen, die vorerst Interesse zeigten, wurde
ein Weggehen bald zur aussichtsreicheren Option. Wassily
Kandinsky (1866-1944) wählte sie, nach Mitarbeit
im Kommissariat für Volksaufklärung, Leitung
der „Freien Staatlichen Kunstateliers" und
des „Museums für Malkultur" endgültig
1921, Naum Gabo (1890-1977) und Marc Chagall (1887-1985)
im Jahr darauf. Malewitsch (1879-1935), der ab 1928
wieder gegenständlich malte, Tatlin (1885-1953),
Rodtschenko (1891-1956) sind geblieben ... Majakowski
schied 1930 freiwillig aus dem Leben; sein Begräbnis
wurde zum radikal durchgestalteten Manifest. EI Lissitzky
kooperierte in Moskau mit Tatlin und den von Malewitsch
später als „Ingenieure" für „Maschinenkunst"
diskreditierten Konstruktivisten, ging 1921 wieder nach
Deutschland, verstand sich im Weiteren als Vertreter
fortschrittlicher russischer Kunst im Westen, arbeitete
und lehrte aber immer wieder in Moskau und starb dort
1941. Tatlins berühmter Entwurf für ein „Denkmal
der Dritten Internationale" (1919/20), als Modell
schließlich in Stockholm (1968), London (1971)
und Moskau (1976) rekonstruiert, war etwa vom 1929 zum
Staatsfeind erklärten Leo Trotzki vor allem im
Vergleich zum Eiffelturm wegen mangelnder Funktionalität,
somit auch mangelnder Schönheit kritisiert worden.
(8) Die „Erste
russische Kunstausstellung" in Berlin von 1922
hatte noch den Anschein erweckt, die eingeschlagene
Richtung würde für umfassende Gestaltungsansprüche
tatsächlich auf lange Sicht bestimmend bleiben.
Trotz des sofort einsetzenden Drucks von außen,
einschließlich massiver Militärinterventionen
im Bürgerkrieg, und der rigiden, gegen „Klassenfeinde"
und „Abweichler" gerichteten Politik im Inneren
ergaben sich auf vielen Ebenen kontinuierliche internationale
Kooperationen. Beeindruckt hat, vor allem auch angesichts
der weltweiten Wirtschaftsdepression dieser Zeit, wie
aktiv versucht wurde, Expertenwissen zu mobilisieren,
klassenlose Modernität durchzusetzen, Frauen gleiche
Chancen zu eröffnen. Von Architektur, Städtebau,
Design, Typografie, Grafik, Film, Theater bis zu Volksbildung
und gigantischen Industrievorhaben entstanden ausstrahlende,
also auch anziehende Energiefelder. Le Corbusier baute
den Centrosojus-Palast in Moskau (1930) und nahm neben
Walter Gropius, Hans Poelzig, den Brüdern Perret
oder Naum Gabo am Wettbewerb für den Sowjetpalast
(1931- 1933) teil, für den aus aller Welt 272 Projekte
eingereicht worden waren. Alvar Aalto projektierte 1935
die finnische Botschaft in Moskau. Der 1930 aus politischen
Gründen entlassene Bauhausdirektor Hannes Meyer
oder Margarete Schütte-Lihotzky und Ernst May übersiedelten
für einige Jahre ganz in die Sowjetunion.
Die Modernität der Wirtschaft in den USA, mit
der wissenschaftlichen Betriebsführung des Taylorismus
und Henry Ford als Leitbildern, wurde zum nachahmenswerten
Modell. Stalin postulierte 1924: „Die Kombination
aus dem russischen revolutionären Schwung und dem
amerikanischen Leistungswillen ist der Kern des Leninismus."
(9) „Amerikanische
Fabrikanten, Industriearchitekten und Beratungsfirmen
für Maschinenbau und industrielle Architektur"
waren maßgeblich am intensiven, später beidseitig
gern verschwiegenen Technologietransfer beteiligt; „1927
verkündete die Ford Company stolz, dass 85 Prozent
der Lastwagen und Traktoren in Russland von Ford gebaut
worden seien". (10)
Bis zum Ende der Sowjetunion blieb es erklärtes
Ziel, die USA wirtschaftlich zu überholen, „aus
Russland eine Art besseres Amerika" zu machen;
die Losung „Einem Bolschewiken ist nichts unmöglich"
stand am Anfang dieser lntentionen. (11)
Was die sowjetische Verfassung dekretierte: „Jeder
nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung",
oder: „Die gesellschaftlich nützliche Arbeit
und ihre Ergebnisse bestimmen die Stellung des Menschen
in der Gesellschaft" (Artikel 14, Fassung von 1977),
passt inzwischen längst in jede Corporate-Identity-Satzung,
nur wird dann eben unter „Gesellschaft" das
jeweilige Unternehmen verstanden.
Wie bittere Ironie wirkt es, dass das in der präsentierten
Auswahl enthaltene, 1926 produzierte Kinderbuch von
Ossip Mandelstam (1891-1938) kryptisch „Die Küche"
heißt und von reichhaltigem Essen in einer arbeitsamen
Welt handelt; die Bilder zeigen die Vorgänge beim
Kochen eines üppigen Frühstücks, eine
markante Wanduhr soll zu Eile und Pünktlichkeit
anspornen. Seit seinem ersten Gedichtband „Kamen"
(„Stein", 1913) mit Nikolai Gumiljow (exekutiert
1921) und Anna Achmatowa (1889-1966) prägende Kraft
des „Akmeismus" (den er einmal lakonisch
als „Sehnsucht nach einer Weltliteratur",
genauso aber nach einer „Weltkultur" definierte),
war er schon im Zuge der Machtkämpfe nach Lenins
Tod am 21. Jänner 1924 immer mehr ins Abseits geraten,
wurde verbannt, wegen konterrevolutionärer Tätigkeit
neuerlich verurteilt und starb kurz vor Kriegsbeginn
auf dem Weg in die berüchtigten sibirischen Lager
an der Kolyma. Stalins als schlichter Brief im „Bolschewiken"
veröffentlichte Forderung von 1930, „nichts
zu drucken, was von der offiziellen Linie abwich",
genügte bereits, so Mandelstams Witwe Nadeschda,
um den Aktivisten in den Apparaten, einschließlich
dort tätiger Künstler, die Richtung zu weisen.
Ab 1932 durfte, wie in NS-Deutschland mit seinen Berufsverboten
und Bücherverbrennungen, nur mehr im Rahmen einheitlicher
Künstlerverbände agiert werden, ab 1934 wurde
der Sozialistische Realismus – dem „Bild
des neuen Menschen" verpflichtet – zur vorgeschriebenen
Doktrin. (12)
Dass heute maßgebliche Künstler wie llya
Kabakov und Erik Bulatow (beide 1933 geboren) lange
im offiziellen Beruf Kinderbuchillustratoren waren und
viele Dichter „nur" als Kinderbuchautoren
veröffentlichen durften, könnte als Beleg
für die Wertschätzung fundierter Erziehung
gesehen werden, macht letztlich aber vor allem Überlebensmöglichkeiten
evident – Kinderbücher als Refugium für
absurden Humor, Humor als unbesiegbare Gegenkraft jedes
Totalitarismus. (13)
Die zu Breschnews Zeiten entstandenen Illustrationen
von Ilya Kabakov in „Geologie in Bildern"
(Moskau 1975, deutsche Ausgabe Berlin 1980; Text: Anatoli
F. Tschlenow) zeigen die Welt von ihrer praktischen
Seite; überall wird Erz, Kohle, Erdöl abgebaut;
Bodenschätze mit modernsten Ortungsmethoden von
Flugzeugen und Satelliten aus aufzuspüren, wird
Kindern „von acht Jahren an" als Errungenschaft
schlechthin nahe gebracht.
Zu dieser Art von Fortschrittsglauben notierte Walter
Benjamin, als er um die Jahreswende 1926/27 für
einige Wochen in Moskau war: „Entfernung der Opposition
aus den leitenden Stellen" – „reaktionäre
Wendung der Partei in kulturellen Dingen" –
„Umstellung der revolutionären Arbeit in
die technische". Er ging viel ins Theater und traf
mit einer Reihe führender Exponenten des kulturellen
Lebens zusammen. Ob er der Kommunistischen Partei beitreten
sollte, wie so viele prägende Intellektuelle dieser
Zeit, beschäftigte ihn als zögerndes Abwägen
von Vor- und Nachteilen; dafür spräche „organisierter,
garantierter Kontakt mit Menschen", dagegen „die
völlige Preisgabe der privaten Unabhängigkeit".
Fasziniert hat ihn, was andere gar nicht bemerkten.
Er kaufte begeistert Beispiele russischen Spielzeugs,
die Kinderbuchsammlung des Gosverlags hat er extra aufgesucht,
eine Ausstellung von Zeichnungen Geisteskranker in seine
Recherchen einbezogen – dies sichtlich auch deswegen,
weil ihm ein schließlich nicht zustande gekommenes
Dokumentarwerk zum Thema „Die Fantasie" vorgeschwebt
ist. (14)
Zur weltweiten Popularisierung der Revolution hatte
ein amerikanischer Journalist wesentlich beigetragen,
John Reed, der zum Freund Lenins, Anführer der
in Chicago gegründeten „Communist Labor Party"
und Leitungsmitglied der Kommunistischen Internationale
wurde („Zehn Tage, die die Welt erschütterten",
1919). Er starb 1920 in Moskau an Typhus. Spätere
Berichterstatter, wie Egon Erwin Kisch, Mitbegründer
des „Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller"
(gestorben 1948 in Prag), oder Joseph Roth (er, so Walter
Benjamin, ist „als [beinah] überzeugter Bolschewik
nach Russland gekommen" und hat es „als Royalist"
verlassen (15)),
sahen die Dinge bereits differenzierter, in der Regel
aber mit neugieriger Sympathie. Bertolt Brecht, der
schon zuvor öfters in der Sowjetunion gewesen war,
floh im Frühjahr 1941, knapp vor dem deutschen
Vernichtungsangriff auf das Land, von seinem finnischen
Exil aus, ohne sich länger in Moskau aufzuhalten,
mit der Transsibirischen Eisenbahn und dann per Schiff
in die USA. Bald „unamerikanischer Aktivitäten"
beschuldigt, verließ er sie 1947 wieder, zu einer
Zeit, als das von antikommunistisch und antisemitisch
orientierten Netzwerken bis hin zum Vatikan organisierte
Entkommen von NS-Kriegsverbrechern aus diversen Ländern
nach Übersee (von Eichmann bis zu „militanten
Katholiken" wie dem Ustascha-Führer Ante Pavelic)
voll angelaufen war. Vorher unüberbrückbar
Erscheinendes formierte sich zu neuen Polaritäten.
Dass der Erste Weltkrieg als bis dahin unvorstellbare
Zäsur zwischen Altem und Neuem erfahren worden
war, mit seinen Millionen Toten, dem Gaskrieg, der Gewalt
neuer Waffen, der trostlosen Situation nach dessen Ende,
hatte nachhaltigen, sowohl Utopien als auch brutalste
Destruktion bestärkenden Einfluss, mit ständigen
Vermischungen von „rechts" und „links",
von Phrasen und Terror, von Volksnähe und Führerkult.
Nicht nur in Russland, sondern kurzfristig auch in Budapest,
in München waren „Räterepubliken",
also „Sowjets" entstanden, bürgerlich-liberale
Demokratien fanden wenig Rückhalt, autoritäre
Machtstrukturen – Mussolini, Stalin, Hitler, Japan
– konnten zunehmend das Geschehen dominieren.
Dass für reichere Teile Europas doch noch von einem
tendenziell sozialdemokratisch geprägten Jahrhundert
gesprochen werden kann (Stichwort: liberaler Sozialstaat),
wirkt rückblickend wie eine kompromissbereite Sublimierung
früherer Radikalität. Die vor allem anfänglich
so verbreitete, sich später vielfach „linientreu"
verhärtende Faszination für die Sowjetunion,
als in kulturell-politischem, umfassendem Sinn greifbar
erscheinendes „Anderes", als „antikapitalistische",
aber für demokratisch-linke Positionen bald irrelevant
gewordene Leitinstanz, ist Teil dieser Geschichte, analog
zum latenten Aufleben mehr oder minder radikaler „rechter"
Kräfte, die sich stereotyp stets als eine Art moralische
Reserve verstehen. Wird jedoch all diese Fragwürdigkeit,
bis hin zur Verwandtschaft im Autoritären, im Nationalistischen,
werden die wahnwitzigen Schauprozesse, die Millionen
in den Lagern des Gulag für ein Aufrechnen mit
den Gräueln der Gegenseite benutzt, negiert das
jenes maßlose, von innen und außen her verursachte
Leid der Bevölkerung im damaligen Russland, relativiert
das völlig unzulässig die aggressiv expansive,
rassistische, industriell mordende Motorik des Dritten
Reichs. Eine 2004 an die Grenzen dieser Desasterregionen
herangeführte Europäische Union wird noch
für Jahrzehnte gefordert sein, um eine tatsächlich
tragfähige Neupositionierung der Beziehungen und
eine ökonomische Balance zu bestärken.
Aus russischer Sicht jedenfalls fehlt es nicht an Einsichten
in das interne, schließlich unumkehrbare Kräftespiel
während der ersten Phasen dieser Entwicklung. Denn
da sich, so Boris Groys, anders als im Westen mit seiner
machtlosen Avantgarde, die russische Avantgarde mit
dem bolschewistischen Regime zusammengetan hatte und
sie am „roten Terror" gegen die – so
wie anderswo auch – „ästhetisch konservative"
lntelligenzija beteiligt war, welche „damals eine
ganz normale, liberale, eher links und fortschrittlich
eingestellte, durchwegs zivilisierte Gesellschaftsschicht
europäischen Typs" gewesen ist, konnte die
„physische Eliminierung dieser Klasse" von
den einbezogenen Künstlern „als Geländebereinigung
für ihr eigenes Wirken" aufgefasst werden.
So freute sich Malewitsch „über die Errichtung
der Diktatur des Künstlers über die Kunstinstitutionen,
die es ihm gestatte, die ganze Gesellschaft zu einem
Leben innerhalb seines totalen Kunstprojekts zu zwingen".
(16) Nabokov
hielt solche Auffassungen für reine Wortspiele,
denn „ein Russe" sei „künstlerisch
umso konservativer, ( ... ) je radikaler er sich in
der Politik" gebärde, war also überzeugt,
dass „die Verbindung zwischen avantgardistischer
Politik und avantgardistischer Kunst rein verbaler Natur"
gewesen sei („aber gern von der sowjetischen Propaganda
ausgenutzt wurde)". (17)
Die „konservative" Wende des späten
Malewitsch scheint dem zu entsprechen. Selbst wenn der
Verbalradikalismus solcher Statements als poetische
Überhöhung relativiert und von Realisierungsfantasien
abgekoppelt wird, bleibt evident, dass die übliche
Bewunderung von Formalem entscheidende Dimensionen und
Querverbindungen ausblendet, waren doch die Kunstinstitutionen
in die Strategieänderungen aller Kunstsparten voll
eingebunden, also in die Transformation von Kunst in
Kultur. Außerdem, so Boris Groys, „verfolgte
die stalinistische Kultur weit aufmerksamer, als man
gemeinhin annimmt, die westlichen Neuerungen und wählte
daraus vor allem aus, was ihr am vitalsten, optimistischsten,
gesündesten erschien, also die totalitären
Tendenzen der damaligen westlichen Kultur. Was die stalinistische
Kultur als Ureigenstes ausgab, erweist sich bei näherer
Betrachtung durchweg als direkte Entlehnung. Selbst
ein oberflächlicher Blick auf die stalinistische
Kultur erkennt große stilistische Ähnlichkeit
zwischen ihr und zum Beispiel Nazideutschland."
(18) Wird dem
gefolgt, hätte auch die Politik gegenüber
„entarteter Kunst" westliche Vorbilder; interessanterweise
wurde Ausgesondertes jedoch meistens aufbewahrt. Jedenfalls
sollte da und dort Widersprüchliches, nur durch
Einfühlung Verständliches nicht weiter die
Geister verwirren. Macht zu demonstrieren und vorübergehend
negative, vielfach kaum beachtete „Begleiterscheinungen"
(die Kollateralschäden heutiger Militärsprache)
in Kauf zu nehmen, ist auch auf künstlerischen
Ebenen vielfach bedenkenlos akzeptiert worden. Deshalb
sei die auch für Boris Groys unbestrittene Größe
der russischen Avantgarde „nicht zu trennen von
ihrer Bereitschaft, die historische Schuld für
ihre Zeit und alle Verbrechen dieser Zeit auf sich zu
nehmen". (19)
Während in der Literatur Bulgakow, Achmatowa, Pasternak
oder Mandelstam „nun allgemein kanonisiert werden",
„hält die gesamte russische Fachwelt –
mit Ausnahme weniger im Grunde am Westen und den dort
geltenden wissenschaftlichen Vorstellungen orientierten
Enthusiasten – die Wiedererweckung der Avantgarde
noch heute weder für nötig noch für wünschenswert".
(20) Auch deshalb
sei es mit Blick auf solche Zusammenhänge erst
seit der Selbstauflösung der Sowjetunion 1991 möglich,
die Abfolgen von Suprematismus, Konstruktivismus, Sozialistischem
Realismus, offizieller und inoffizieller Kunst sowie
das Erweitern und Unterlaufen von Zensurbarrieren differenzierter
zu analysieren. Anders als im Westen wirke in russischen
Auffassungen eben gravierend nach, dass „seit
der Mitte der 30er Jahre ein sehr spezifischer, einheitlicher
künstlerischer Stil, der alle Aspekte des sozialen
Lebens gestaltet und tief geprägt hat", die
Vorstellungen von Kunst als „ein an den Betrachter
gewandtes Kommunikationsmittel" dominierte. (21)
Wenn selbst Experten des New Yorker Museum of Modern
Art (gegründet 1929, seit 1939 mit eigenem Gebäude
– zwei auch sonst historisch relevante Daten)
in einem aktuellen TV-Porträt dieser Institution
längst nichts mehr dabei finden, von der Kunst
in der frühen Sowjetunion als einem „enorm
optimistischen Experiment" zu reden, scheint deren
Endlagerung in Museen schon jede Erinnerung eliminiert
zu haben an die politische Benutzung alles „Abstrakten"
zu Zeiten des Kalten Krieges – als die „freie",
dem Westen gehörende Kunst schlechthin. Nur ein
aktualisiertes Wahrnehmen zugrunde liegender geistiger
Prozesse und zugehöriger Umstände kann solchen
sterilisierenden Einordnungen entgegenwirken. „In
der Geschichte unserer Gattung, in der Geschichte des
homo sapiens", betonte Joseph Brodsky in seiner
Nobelpreisrede von 1987 – einem Plädoyer
für sorgfältige, in ihren Aussagen provisorisch,
also für weiterführende Gedanken offen bleibende
Differenzierungen –, „stellt das Buch eine
anthropologische Leistung dar ähnlich der Erfindung
des Rades. Entstanden, um uns eine Idee zu vermitteln
nicht sosehr von unseren Ursprüngen als von den
in uns schlummernden Fähigkeiten, stellt das Buch
ein Mittel der Fortbewegung durch einen Erfahrungsraum
dar, dessen Tempo dem Umblättern einer Seite entspricht.
Diese wie jede andere Bewegung auch wird zur Flucht
vor dem gemeinsamen Nenner, zum Versuch, die Sprunghöhe,
die sonst nur bis zur Hüfte reicht, nach oben zu
verschieben, in die Höhe des Herzens, des Geistes
oder der Fantasie. Es ist eine Flucht hin zum unverwechselbaren
Gesicht, vom Nenner zum Zähler, in Richtung auf
Privatheit und Individualität." (22)
Bei Wladimir Majakowski finden sich analoge Aussagen.
„Wir wissen: Die Zukunft gehört dem Fotoapparat,
dem Funkfeuilleton, der Kinopublizistik", heißt
eines seiner Statements aus Zeiten, in denen es noch
kein Fernsehen gab; aber selbst angesichts eines Massenpublikums
könne ein an wenige adressiertes Buch höchst
notwendig sein, sofern es sich „nicht an Verbraucher,
sondern an Erzeuger" wende. (23)
Für solche „Erzeuger", egal welchen
Alters, dürften einige der in diesem Band versammelten
Beispiele gedacht gewesen sein – denn „in
gewissem Sinn ist schließlich alle Kunst eine
Sache der Orientierung" (Nabokov). (24)
PS: Die einprägsamste Kinderbuchszene seit langem
ist bekanntlich US-Präsident George W. Bush zu
verdanken. In der Emma E. Booker Elementary School in
Sarasota, Florida, die er gerade auf einer Goodwill-Tour
besuchte, hat er nach der ihm zugeflüsterten Nachricht
von den Attacken des 11. September 2001 – sieben
Minuten lang, wie es in allen sorgfältigen Berichten
dazu heißt – gedankenverloren, offenbar
um sich abzulenken, um Zeit zu gewinnen, in das dadurch
berühmt gewordene Buch „My Pet Goat"
geschaut. Auf dutzenden Internetseiten wird spekuliert,
um welche Ausgabe es sich gehandelt haben könnte.
Der gerahmte Sinnspruch im Hintergrund des vielfach
ausgestrahlten Szenarios erinnert an Essenzielles: "READING
MAKES A COUNTRY GREAT!"
|
| Quellen
1 Karl Popper: Die offene Gesellschaft
und ihre Feinde, erste englische Ausgabe London 1945,
erste deutsche Ausgabe Bern 1957; München 1977.
2 Hans Magnus Enzensberger: "Plädoyer
für den Hauslehrer" (1982), in: H. M. Enzensberger:
Politische Brosamen, Frankfurt am Main 1985, S. 161ff.
3 Boris Groys: Gesamtkunstwerk Stalin.
Die gespaltene Kultur der Sowjetunion, München
1988, S. 17, 12, 19, 14.
4 Kasimir Malewitsch, herausgegeben
von Evelyn Weiss, Köln 1995, S. 127.
5 Kasimir Malewitsch: Suprematismus
– Die gegenstandslose Welt (1922), herausgegeben
von Werner Haftmann, Köln 1989.
6 Boris Groys: Gesamtkunstwerk Stalin,
a.a.O., S. 72.
7 Vladimir Nabokov: Erinnerung, sprich.
Wiedersehen mit einer Autobiographie (New York 1966),
Reinbek bei Hamburg 1991, S.377,381.
8 Boris Groys: Die Erfindung Rußlands,
München 1995, S. 115.
9 Josef W. Stalin, zit. nach: Thomas
F. Hughes: Die Erfindung Amerikas. Der technologische
Aufstieg der USA seit 1870, München 1991, S. 255.
10 Thomas P. Hughes: Die Erfindung
Amerikas, a.a.O., S. 156, 276.
11 Boris Groys: Gesamtkunstwerk Stalin,
a.a.O., S. 49, 67.
12 Nadeschda Mandelstam: Das Jahrhundert
der Wölfe, Frankfurt am Main 1971/1991, S. 285,
298f.
13 Boris Groys: Die Erfindung Rußlands,
a.a.O., S. 207.
14 Walter Benjamin: Moskauer Tagebuch,
Frankfurt am Main 1980, S. 19, 120, 108, 144, 77, 82.
15 Ebd., S. 43.
16 Boris Groys: Die Erfindung Rußlands,
a.a.O., S. 95f.
17 Vladimir Nabokov: Erinnerung, sprich,
a.a.O., S. 357.
18 Boris Groys: Die Erfindung Rußlands,
a.a.O., S. 54.
19 Ebd., S. 101.
20 Boris Groys: Gesamtkunstwerk Stalin,
a.a.O., S. 37.
21Boris Groys: Die Erfindung Rußlands,
a.a.O., S. 146, 103.
22 Joseph Brodsky: Das Volk muß
die Sprache der Dichter sprechen. Rede bei der Entgegennahme
des Nobelpreises für Literatur, in: Joseph Brodsky:
Flucht aus Byzanz. Essays, München 1988, S. 14.
23 Wladimir Majakowski: Werke, herausgegeben
von Leonhard Kossuth, Frankfurt am Main 1980, Band V.2.,
Publizistik. Aufsätze und Reden, S.328, 299.
24 Vladimir Nabokov: Erinnerung, sprich,
a.a.O., S. 293
|
|