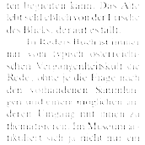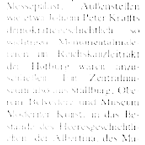|
Unternehmenskultur kann als Austauschverhältnis aufgefaßt
werden: Was prägt von außen her die ideelle und materielle
Situation in einem Betrieb, wie wirkt dieser selbst nach außen,
was charakterisiert sein Eigenleben? Wie steht es um die Konfliktfähigkeit,
welche Begrenzungen, Filter, Informationskanäle und Bilder
sind für die jeweils spezifische Art des Transfers charakteristisch?
Was davon ist »Wirklichkeit«, was wird sichtbar, was bleibt
verborgen?
Offenkundig ist doch, daß Realität und Betrachter von einer
dazwischengeschobenen Ebene der Bilder getrennt werden. In
der Mediengesellschaft ist jeder auf Bilder, auf Abbilder,
auf bloße Simulation angewiesen. Zeichensprache und Kürzel
haben viel mehr Kraft als »inhaltliche« Informationen.
Wie verfestigen und verändern sich solche »Bilder«? Was
unterliegt eigenen, was fremden Einflüssen? Was passiert bloß,
sozusagen von selbst, was wird noch bewußt »gestaltet«?
Und gibt es überhaupt noch »die Anderen«, »die Fremden«,
mit denen sich eine die eigene Kultur prägende Auseinandersetzung
lohnt und von denen Unternehmenskulturen über das Kopier-
und Konkurrenzsystem hinaus Impulse erhalten könnten? Unübersehbar
ist doch, daß es in der Informationsgesellschaft keineswegs
leichter geworden ist, seismographische Kontakte wahrzunehmen.
Neue Fragen, andere Denkweisen, überzeugende Gestaltungskonzeptionen,
sich ändernde Lebensformen verwandeln sich angesichts der
globalen Unübersichtlichkeit eben nicht so einfach in abrufbare
Dienstleistungen.
Zugleich hat unsere Produktkultur einen Sättigungsgrad erreicht,
der gerade »das Andere«, das in sehr spezifischer Weise Neue
zur wirtschaftlichen Notwendigkeit macht, vom erzeugten Produkt
über die Werbung bis zum Imagetransfer, vom sensibilisierten
Betriebsklima über intelligente Technologienutzung bis zu
zeichensetzender Architektur. Wie schwer es vielen Unternehmen
fällt, im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Handlungszwänge eine
eigene »Kultur« auf solchen Gebieten zu demonstrieren, ist
unter anderem eine Frage der benutzten Informationswege. Irgendeine
Form hauseigener Kultur bildet sich in jedem Betrieb. Gefährdungen
ergeben sich, wenn die Kommunikation zu stereotyp in üblichen
Bahnen kreist. Widerstandskraft entsteht durch Auseinandersetzungen
und kompakte - also nicht endlos zergliederte - Arbeits- und
Entscheidungsprozesse.
Eine erste These zu diesem Dilemma: Schaffung einer Projektkultur.
Trotz der Projektinflation in vielen Wirtschaftszweigen (vom
Bausektor bis zu Filmproduktionen) wird die Notwendigkeit,
herkömmliche Organisationsgebilde in mobilisierender Weise
umzuformen, immer noch zu wenig beachtet. Verkürzt gesagt
sind nämlich wirkungsvolle Strukturen für kontinuierliche
Daueraufgaben anzustreben, die zugleich animierende Gehäuse
für eine Vielzahl temporärer Projekte sind. Für eine Lebendigkeit
und Beweglichkeit - auch der Unternehmenskultur - sorgen nämlich
Projekte viel eher als noch so perfekt gemanagte Geschäftsabläufe.
Erst in Projekten können Isolationen aufgebrochen werden durch
die Überwindung von Abteilungsgrenzen, durch die Einbeziehung
freischaffender Mitarbeiter, durch Impulsgeber aus verschiedensten
Bereichen, durch Berater, Kritiker, Designer, Architekten,
Experten, Studenten, Autodidakten, Laien. Wenn Versuche in
dieser Richtung unbefriedigend verlaufen sind, muß die Art
der Projektorganisation, der Vereinbarungen, der Planung,
der Personenauswahl neu überdacht werden. Jedenfalls: Die
überall gegebene Tendenz zur Informationsisolation ist am
ehesten durch sensibilisierte und kenntnisreiche Personen
aufzubrechen, die mit entsprechender Bestärkung und Autonomie
arbeiten können.
Unter dem Titel Unternehmenskultur - so eine weitere These
- ist also die Bereitschaft zu weitgefaßten Ideenfindungsprozessen
besonders wichtig. Zivilisation - der im Englischen gebräuchlichere
Begriff für Kultur - setzt ja gedankliche Bestrebungen voraus,
die weit über unmittelbare Nützlichkeiten hinausreichen und
subtile, indirekte, vernetzte Wege miteinschließen.
Ein Beispiel dafür wäre die Einbeziehung unterschiedlich
denkender Berater in die Prioritätensetzung, sei es bei der
Projektplanung, sei es in Beiräten oder Aufsichtsräten. Warum
haben dabei Künstler, Architekten, Wissenschaftler, Designer
noch so selten das ihnen gebührende Gewicht? Es muß permanent
an Kommunikationsformen gearbeitet werden, die mehr bieten
als unverbindliche Anregungen und die Betrieben tatsächlich
erweiterte gedankliche Bezugsfelder erschließen. Dazu könnte
etwa die Analyse von Produkten und Dienstleistungen unter
dem Gesichtspunkt des Zeitbedarfs für ihre Nutzung zählen
(ein Projekt »Zeit-Kultur« also). Ansatz dafür ist die Überlegung,
daß Kaufentscheidungen zunehmend mit einem geänderten Bewußtsein
von Konsumzeit verknüpft werden. Wieviel Zeit haben bestimmte
Gruppen von Konsumenten jetzt und in überschaubarer Zukunft
letztendlich für einander konkurrierende Aktivitäten zur Verfügung?
Wie verändern die »Zeitbudgets« Lebensstile? Wie wird sich
der allgemeine Verfügbarkeitskult weiterentwickeln? In diesem
Zusammenhang tauchen laufend neue Fragen auf: Wie läßt sich
Zeit konzentrieren, speichern und verfügbar halten? Bei Büchern,
Schallplatten, Tapes, Videos, Kühlschrankware, Bankomatkarten
oder Personal Computern habe ich diese Speichermöglichkeit,
d. h. es bleibt mir überlassen, wann ich mir die Zeit für
etwas nehme. Vielfach ist man aber an fixe »Benutzungs«-Zeiten
gebunden (Geschäfte, Firmen, Restaurants, Fluglinien, Eisenbahn,
TV, Kino, Konzert, Theater). Beim Konsum von Zeitschriften,
Videos, Schallplatten, Büchern ist das anders, und bei Ausstellungen
gibt es auch deswegen einen weltweiten Boom, weil sie beliebiger
zugänglich sind. Der Trend zu längeren Geschäftszeiten trotz
Arbeitszeitverkürzung sollte auch unter solchen Aspekten in
die Überlegungen mit einbezogen werden. Restaurantbesuche
und Urlaubsreisen wiederum können ebenfalls als Zeitspannen
interpretiert werden, die in einer bestimmten Preiskategorie
für ein Social event aufgewendet werden. Man kann auch soweit
gehen und Konsumzeit als gespeicherte Produktionszeit (bzw.
Gelderwerbszeit) auffassen. Und Analysen des Zeiteinsatzes
für Shopping (Anfahrt, Auswahl, Transporte, Bankbesuche, Buchführung,
Bindung an Öffnungszeiten), für Reparaturen bis hin zu sich
verändernden Strukturen des Besitzdenkens und Freizeitverhaltens
könnten in Betrieben aller Größenordnungen zu einer erhöhten
Aufmerksamkeit gegenüber kulturellen Veränderungen führen.
Eine solche Offenheit wird sowohl auf die Einschätzung von
Nachfragetrends, Sättigungsgraden und eigener Zeitprioritäten
als auch auf die jeweilige Unternehmenskultur zurückwirken.
Notwendig ist also ein Mut zu ungewöhnlichen Kooperationen,
etwa mit unkonventionell zusammengesetzten Beratergruppen
oder durch eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit Universitäten
und Kunsthochschulen. Das weitverbreitete Unbehagen über die
vielen solchen Intentionen entgegenstehenden Barrieren hat
im Kern eine Ursache: Projekte werden nicht gründlich genug
konzipiert und geplant. Experimentelle Arbeitsbedingungen
stoßen ganz allgemein auf zuwenig Einfühlungsbereitschaft.
Zwei Kulturen verkehren miteinander entweder zu unverbindlich,
selbstgefällig und gönnerhaft oder bloß in Form einseitig
dominierter Zweckbündnisse. Im Grunde geht es doch schlicht
um Ideenprojekte, Auftragsarbeiten (Forschung, Entwicklung,
Gestaltung), um Wettbewerbe und um die Chance, daß tatsächlich
etwas realisiert wird.
Universitäten sind gut beraten, wenn sie für Vermittlung,
für Dienstleistungen, für Informationslieferung und für die
Beratung Instanzen einrichten, wie sie etwa die Hochschule
für angewandte Kunst in Wien durch ihre Lehrkanzel für Kunst-
und Wissenstransfer, die vom Autor dieses Beitrages geleitet
wird, als Anlaufstelle anbieten kann. Damit steigen auf beiden
Seiten die Chancen, daß Bereichsegoismen überwunden werden
und Projektgruppen in interdisziplinärer Weise arbeiten können.
Für den Schutz geistigen Eigentums müssen von Beginn an
klare Regelungen getroffen werden. Zeitpläne sind dem Universitätssystem
anzupassen. Theorie und Praxis sollten in der Regel in bestimmten
Etappen miteinander konfrontiert werden, ohne daß zu früh
eine Einengung verordnet wird. Eine kompetente Projektbetreuung
kann viel für eine geeignete Arbeits- und Vertragskonzeption
tun und zur Konfliktregelung herangezogen werden. Besonders
wichtig ist die Kontinuität von Kooperation, damit Arbeitsergebnisse
nicht als billige Ideenlieferungen mißbraucht werden und tatsächlich
längerfristig fruchtbare Transferbeziehungen entstehen.
Dazu einige Fallbeispiele aus dem für die Unternehmenskultur
besonders signifikanten Bereich Gestaltung: Der Kunststoffkonzern
Optyl nutzt schon seit Jahren den kreativen Output von Kunsthochschulen,
und zwar keineswegs nur auf seinen eigentlichen Produktionsschwerpunkt
Brillendesign bezogen, sondern auf Mode- und Textilentwürfe
übergreifend. Neue Farben, Muster, Formen sind ihm wichtig
als Ausdruck von Produktkultur und unabhängig von unmittelbaren
Umsetzungsmöglichkeiten. Auch die Modeschau »Womensyndroma«
(1989) der von Jean Charles de Castelbajac geleiteten Meisterklasse
für Mode an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien ist
aus solchen Überlegungen heraus von Optyl mitfinanziert worden.
Der Wiener Böhlau-Verlag wiederum hat kürzlich einen Wettbewerb
über seine Corporate Identity veranstaltet, um aus den Preisträgern
Mitarbeiter für die schrittweise Neukonzeption seines Erscheinungsbildes
zu gewinnen. Für die Firma Schneiders werden gerade Handtaschenentwürfe
erarbeitet. Die Zumtobel AG wiederum war von einer Diplomarbeit
zum Thema »Leuchten« so beeindruckt, daß sie der Designerin
sofort die Weiterführung dieser Arbeit im Unternehmen ermöglicht
hat. Der Wettbewerb des Büromöbelherstellers Vitra hat zur
Entwicklung äußerst signifikanter Entwürfe geführt. Den ersten
Preis erhielt ein Klappstuhl von Werner Schmidt (Meisterklasse
Prof. Hans Hollein). Sieger des Internationalen Wettbewerbs
»Sperrholz-Formteile im Möbel-Design«, den die bundesdeutsche
Fritz Becker KG veranstaltet hat, waren - mit einem Bücherregal
- ebenfalls zwei Studenten einer Wiener Designklasse (Thomas
Exner und Christian Steiner). Mit Villeroy & Boch, Hutschenreuther/
Arzberg, und WMF-Württembergische Metallwarenfabrik gibt es
seit nunmehr drei Jahren eine kontinuierliche Zusammenarbeit.
Inzwischen sind von Studenten der Meisterklasse für Keramik-Produktgestaltung
(Prof. Matteo Thun) eine Reihe serienreifer und bereits am
Markt befindlicher Produkte zum Thema Eß- und Tischkultur
konzipiert worden. Gearbeitet wurde in den Wiener Hochschulateliers
und in den Produktionsstätten in der Bundesrepublik. Auszeichnungen
gab es beim »Design-Plus«-Wettbewerb auf der Frankfurter Frühjahrsmesse
1988. Daß drei marktbestimmende Konkurrenten erstmals gemeinsam
Entwicklungsaufträge durchführen ließen, die nur inhaltlich
von einander abgegrenzt waren, kann als bemerkenswerte Offenheit
interpretiert werden. Die für Villeroy & Boch hergestellten
Service sind bereits im Handel und werden mit viel Medienbeachtung
auf einer Wanderausstellung in der Bundesrepublik, in den
USA, in Kanada und in Frankreich gezeigt. Die Bestecke und
Kochgeschirre für WMF und die Dekorteller für Hutschenreuther
sind im Produktionsstadium. Wichtig für den erfolgreichen
Ablauf dieser Entwicklungsarbeiten, die mit neuen Aufgaben
fortgesetzt werden, ist das persönliche Engagement von Mitgliedern
der Geschäftsleitung gewesen. Bei künftigen Vorhaben wird
besonders zu beachten sein, daß zwischen der freien Ideenfindung
und Auftragsarbeiten jeweils neue Konfrontationen und Symbiosen
entstehen können; durchaus im Sinn »zeitorientierter« Projekte
und Kooperationsstrukturen, die jenseits professionell eingespielter
Systeme auch arbeits- und kommunikationsmäßig kulturprägend
sein können.
Primär geht es nicht um das vielzitierte »Sponsoring« sondern
ausdrücklich um ein Überwinden des Sponsordenkens. Man muß
klar sehen, daß Berührungsschwierigkeiten - von Studentenseite
geprägt durch den Vorwurf der Gönnerhaftigkeit, von Wirtschaftsseite
durch jenen der Praxisferne - nur in konsequenten Projekten
auf einem konstruktiven Niveau ausgetragen werden können.
Schauplatz für Annährungen und Konfliktpräzisierung müssen
konkrete »Projekte« sein, die als Chance für die Arbeit außerhalb
eingefahrener »Strukturen« und »Institutionen« - zu denen
Universitäten, Hochschulen genauso gehören wie Unternehmen
- aufgefaßt werden. Unüberbrückbar erscheinende Kontroversen
sind nicht ein Beweis für unüberwindbare Ignoranz auf irgendeiner
Seite, sondern für eine zu schematische Projektkonzeption.
Gerade aus »metaökonomischen« Denkweisen lassen sich entscheidende
Innovationen entwickeln. In einer Welt der Zeichen sind vor
allem Zeichen der Überraschung und Zeichen der Selbstbestätigung
notwendig. Produkterfolge bauen auf komplizierter werdenden
Mechanismen der Akzeptanz auf. Kurzsichtig ist es daher, wenn
ständig eindimensionale Argumente der Machbarkeit und Verkaufbarkeit
in den Vordergrund geschoben werden, was zugleich heißt, daß
gedankliche Möglichkeiten »außerhalb« üblicher Verwertungszwänge
gering geschätzt werden. Gerade die Sättigungsgrade beim gewohnten
Angebot sollten gegenteilige Interessen provozieren: Die Neugier
gegenüber »unbelasteten«, inhaltlich-formalen Gedanken, die
dort ansetzen, wo eingeengte »Professionalität« längst schon
Schwächen zeigt.
|
|