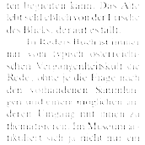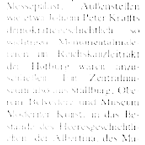|
Als Ansatz zu einigen, eher pragmatischen Überlegungen möchte
ich mich - auch aus staatssymbolischen Gründen - des Burgtheaters
bedienen und eine Stimme aus ihm zitieren, von einem, der
es nach Jahren der Mühe gerade wieder verläßt.
Ignaz Kirchner redet nämlich (im Profil dieser Woche - Nr.
21/92) nicht lange herum. Zitat: >Das Burgtheater ist ein
Status, sonst gar nichts.<, >Die Strukturen an diesem Hause
können nicht aufgebrochen werden< und weiter >Die Verweigerungsfront
ist sogar stärker geworden. Ich nenn' das mittlerweile eine
Aussitz-Mentalität. Es geht hier ums Aussitzen, es geht nicht
um Strukturveränderung.<
In anderen Worten: Pensionsorientierte Arbeitsweisen sind
hierzulande in etablierten Kulturbereichen das Signifikante
schlechthin. Die Dynamik dahinter: Irgendwann, später, gerade
noch zu Lebzeiten, geht die persönliche Rechnung auf, als
sonderbare Kompensation. Das schafft nicht Freiheiten, sondern
Abwehrhaltungen; Ignaz Kirchner spricht auch nicht das hier
so beliebte >Persönliche< an, sondern berechtigterweise die
uniformierenden Mechanismen.
Gewissermaßen als Experte für Strukturen, zu dem ich unter
anderem geworden bin, ermuntern mich solche Aussagen, solche
Gutachten von künstlerischer Seite, weil ich andernorts ständig
Parallelen dazu sehe, weil ich dauernd mit solchen Fragen
nach aktivierenderen Arbeitssituationen zu tun habe.
Nur: Ich habe auch Erinnerungen - unser generelles Thema
hier - und die beweisen mir in einem fort, wie sich solche
Klagen wiederholen, seit Jahrzehnten, ohne irgendein Arbeitsgebiet
zu verschonen, gelegentlich eruptiv-zornig, meistens ermattet-perspektivelos.
Das Burgtheater als Eingangsbeispiel zu nehmen ist vielleicht
zu plakativ-absurd, man kann - bezogen auf Strukturen jetziger
und künftiger Arbeitsweisen - genauso an Spitäler denken,
an Ministerien, Kommunalverwaltungen, Universitäten, an die
desolaten Verhältnisse im Justizbereich, an den Mediensektor
mit seiner oligarchischen Verkrustung - oder eben an Museen,
als wieder in den Blickpunkt geratene Einrichtungen der Erinnerungsverwaltung,
über die ich heute etwas äußern soll.
Analogien zwischen noch so unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern
ergeben sich aus den Deformationskräften der >unsichtbaren
Architekturen<, also der Regelgeflechte, die das Geschehen
prägen. Die >gesteigerte Unsichtbarkeit<, von der heute schon
die Rede war, ist der generelle Kontext dafür.
Stichworte dazu: >verwaltete Welt<, >durchorganisierte Welt<,
angeblich >ökonomisierte Welt<, Dominanz des Immateriellen,
Entmaterialisierten. Schon die sich in diesen Begriffen widerspiegelnde
Totalität und die unentwirrbare Verflechtung von allem und
jedem produziert Lähmung, produziert Desinteresse.
Irgendwo insular anzufangen mit neuen Strukturen, die -
sagen wir - >freiere<, ungestörtere, intensivere Arbeitsweisen
ermöglichen oder wenigstens nicht behindern, damit inhaltliche
Fragen aufgewertet werden, ist kaum einem der Akteure zuzumuten.
Es wird auch nicht belohnt. Einer medialen Vermittlung widersetzt
sich diese Problematik. Es gibt daher nur eine laue öffentliche
Diskussion darüber. Der normale Ablauf ist folgender: Man
muß sich drüberschwindeln, flüchten oder irgendetwas Neues,
Zusätzliches inszenieren, damit im Kern alles beim alten bleiben
kann.
Ein Wunder ist es also nicht, daß sich gestalterische Politik
- die in erster Linie als Strukturpolitik im weitesten Sinne
verstanden werden könnte - von diesen Fragen und all den ermüdenden
Details fernhält, selbst wenn es politisch bloß um eher nebensächliche
Bereiche geht. Hans Ulrich Reck hat, genau in diesem Sinn,
von >zukunftsloser Politik< gesprochen.
Damit in Kauf genommen wird eine >Verwahrlosung der Strukturen<
mit all ihren Pseudoelementen, Simulationen, So-tun-als-ob-Systemen.
Kulturtheoretisch sind dem vielleicht heitere, spielerische
Seiten abzugewinnen.
Auf Arbeitssituationen bezogen halten sich m. E. die Belustigungseffekte
in Grenzen. Denn die Paralysierung >intelligenter Energien<,
um es etwas pathetisch auszudrücken, bräuchte innerhalb und
außerhalb von Institutionen, Firmen, Behörden ja keineswegs
jenes marginale, Romantikern und Bürokraten vorbehaltene Thema
zu sein, das es zu sein scheint, seitdem der Markt auch in
angestammt staatlichen Betreichen mehr oder minder alles regeln
soll.
Immerhin geht es dabei um entscheidende Vorfragen dazu,
was auf welche Weise produziert wird.
Weil sie nur sporadisch und verlegen gestellt werden, bleiben
selbst die unmittelbar erfahrbaren Arbeitsbereiche so diffus,
als Teil scheinbar offenliegender Zusammenhänge, eingebunden
in scheinbare Mitbestimmung nach irgendwann ausgehandelten
Regeln, in die scheinbare Argumentierbarkeit von Entscheidungen,
von Ergebnissen, von Input-Output-Relationen, in die scheinbare
Autonomie >geschützter< Beamter, in scheinbar geordnete Finanzierungswege
etc. etc.
Soweit eine eher generelle Skizze zum Umfeld der Arbeit
in bzw. mit Institutionen.
Die zugehörige These: Mit Kraftakten Einzelner, auch im künstlerischen
Bereich, lassen sich Institutionen nicht nachhaltig umbauen.
Von Zeit zu Zeit muß eine möglichst radikale Evaluierung der
organisatorisch-strukturellen Bedingungen angesagt sein, sonst
bleibt jedes gestalterische Bemühen Dekoration.
Zu meinem engeren Thema >künftige Museumsarbeit< einige
Erinnerungspunkte:
- Auf Bundesebene fließen derzeit rd. 5 Mrd. S. außertourlich
in diesen Sektor (hauptsächlich für Baumaßnahmen, die eine
Hälfte für Renovierungen, die andere Hälfte für das Museumsquartier
im Messepalast)
- mit der Teilrechtsfähigkeit ist die betriebliche Beweglichkeit
etwas erhöht worden
- auch die Erneuerung der internen Strukturen wird nach Jahrzehnten
verwalterischer Passivität in Angriff genommen.
Mit Einzelheiten zum enervierenden Hick-Hack um detailverwobene
Beharrungsmechanismen möchte ich hier nicht fadisierend wirken;
deshalb konzentriere ich mich auf die Betonung einiger Hauptpunkte,
die schließlich - eher fragend - zu einem Szenario künftiger
Museumsarbeit führen.
Strukturentwicklung in Museen muß u. a. bei Überlegungen
zu den Grundaufgaben ansetzen, nämlich Sammeln, Bewahren,
Erforschen, Vermitteln (wie es bei uns sogar gesetzlich festgeschrieben
ist).
Daß keine dieser angeblich unbestrittenen Aufgaben auch
nur hinreichend erfüllt wird, demaskiert die Beliebigkeit
solcher Maximalansprüche. Dieter Bogner hat diese unreflektierte
Museumsdefinition, ganz in meinem Sinn, als >obsolet< bezeichnet,
weil die damit verbundenen Gewichtungen einfach nicht stimmen.
Wörtlich genommen würden, bei offensiver Auslegung solcher
Anforderungen, Museumsmonster entstehen. In der hiesigen Realität
stehen ihnen - in augenfälliger Polarität - immer noch eher
ärmliche, Überforderung mit Passivität und Einzelaktionen
kaschierende Institutionen gegenüber, denen jahrzehntelang
Eigeninitiative abgewöhnt worden ist.
Auf welche erfüllbare Aufgaben soll man sich also konzentrieren?
Was müßte abgebaut werden? Wo ergeben Schwerpunktverlagerungen
und neue Konzentrationen einen Sinn? Normal wäre, daß >neue<
Inhalte von >alten< Strukturen aufgerieben werden. Wie aber
lassen sich also auf der Basis veränderter Strukturen für
Institutionen neue Inhalte entwickeln?
Zum Thema >Sammeln<
Für Sammlungsankäufe stehen allen österreichischen Bundesmuseen
zusammen rd. 30 Mio. öS. jährlich zur Verfügung. Was dafür
gekauft wird, was zusätzlich an Schenkungen hereinkommt, beschäftigt
sonderbarer Weise auch eine interessierte Öffentlichkeit und
die Medien kaum.
Das meiste davon verschwindet genauso, als ob es sich um
Privatsammlungen handeln würde. De facto hat eine >Privatisierung<
der staatlichen Sammlungen längst stattgefunden. Sie >gehören<
gleichsam den zuständigen Kustoden. Das hat einige positive,
genauso aber zahllose verfestigende, abwehrende Komponenten.
Wie sehr administrative >Strukturen<, also Regelungen, das
Geschehen bestimmen, zeigt sich daran, daß in einem von mir
analysierten Wiener Museum 80 % der Ankäufe unterhalb des
Limits, ab dem ministerielle Genehmigungen einzuholen sind,
stattfinden (jetzt 50.000.- früher 30.000.- öS.). Man kauft
also lieber kleinteilig um nicht ansuchen zu müssen, selbst
wenn es fast nie Ablehnungen von oben gibt. Vorfragen jeder
Sammlungspolitik sind also die Arbeitsstruktur, die Entscheidungsabläufe,
die Budgetkompetenzen.
Bei der Sammlungspolitik - wo wird sie eigentlich markant
greifbar? - dreht sich alles - vorerst durchaus zu Recht -
um Objekte. Daß die Gewichtung zwischen Objekten und Informationen
ein überdenkenswertes Strukturelement bilden sollte, hat trotz
angeblicher >Informationsgesellschaft<, trotz aller Betonung
des >Immateriellen< kaum einen Stellenwert. Archivfunktionen
sind eher Nebenaufgaben. Das Museum, als Ort gespeicherten
Wissens, ist eine Fiktion. Der Künstler mit seinem Werkzusammenhang
verschwindet hinter Objektanhäufungen, hinter Themenkonzepten,
hinter einem Name-Dropping, von dem das Museumsverhalten uniformiert
wird.
Zum Thema >Erforschen, Bewahren, Vermitteln<
Wie es um die Wissenschaft in Museen bestellt ist, möchte
ich hier nur sehr vorsichtig fragen. In Wahrheit ist auch
sie gewissermaßen >privatisiert<, findet noch am ehesten in
der Freizeit statt. Der Alltag ist Verwaltung. Auch die Kontakte
zu Universitäten oder Kunsthochschulen laufen eher über >private<
Kontakte. >Öffentlichkeit< dafür gibt es nur punktuell.
Von den Arbeitssituationen ausgehend müßten Strukturentwicklungen
also dezidiert bei den Berufsbildern von Kustoden, von Kunsthistorikern,
von Wissenschaftlern ansetzen; inkl. der Ausbildungswege,
der Mobilität, inkl. mehrdimensionaler, bereichsübergreifender
Berufschancen, inkl. Aufwertung theoretisch-wissenschaftlichen
Arbeitens.
Daß in den mir intern genauer bekannten Museen ein auffallend
schlechtes Betriebsklima herrscht, führe ich primär auf die
Unhaltbarkeit überkommener Anforderungen, Arbeitsweisen und
Entscheidungsvorgänge zurück und auf unreflektierte Diskrepanzen
zwischen Berufsvorstellungen und tatsächlichen Möglichkeiten.
Ansonsten hätte es längst schon einen massiven Reformschub
geben müssen.
Die ständestaatlichen Aspekte prolongieren sich in ungebrochener
Enge. Währenddessen übernehmen Leute mit sozusagen unwissenschaftlichen
Biographien das Geschehen; Künstler als Ausstellungsgestalter,
Ausstellungsmacher und Museumsleiter verschiedensten Backgrounds.
Als deprimierende Zukunft droht anscheinend die Herrschaft
von Kulturmanagern. Seitens der angestammten Fachsparten sind
die Reaktionen darauf erstaunlich hilflos geblieben.
Spezielle Desasterbereiche sind alle sogenannten betrieblichen
Agenden, also das was man unter >normaler< Funktionsfähigkeit
verstehen könnte. Z. B. die Inventarisierung, die Informationsaufarbeitung
insgesamt, denn wenn es schlicht nicht um Hunderttausende
künstlerisch-musealer Objekte gehen würde, sondern etwa um
Münzen oder gar Goldbarren, wären die jahrzehntelangen Fahrlässigkeiten
dabei nie toleriert worden. Ein anderes Beispiel: Die Restaurierung
(oder ist bekannt geworden, daß daraus Kapital geschlagen,
daß Bedrohtes unter Einsatz leistungsfähiger Werkstätten den
Sammlungen zugeführt wird, daß Bestände und Neuzugänge systematisch
in optimale Zustände gebracht werden?).
Anzumerken ist wohl auch, daß es beim >Bewahren< darauf
ankommt, wer es mit Engagement gut macht; der Vergleich zu
Privaten durfte für staatliche Museen nicht sehr erfreulich
ausfallen. Im übrigen ist auch die Leistungsfähigkeit hiesiger
Bibliotheken, als sammelnde Einrichtungen, radikal in Frage
zu stellen, besonders was Angebot, Aktualität, Zugänglichkeit,
internationale Vernetzung betrifft. Ihre Rückständigkeit geht
derzeit noch in Debatten um attraktivere Museen völlig unter.
Wie antiquiert der staatliche Umgang mit seinen Antiquitäten
immer schon gewesen ist, belegt etwa die vor über 100 Jahren
publizierte >Vertrauliche Denkschrift über die Lage am K.K.
österreichischen Museum für Kunst und Industrie< (1885). In
ihr hat der schließlich als unliebsamer Kritiker und Aktivist
entlassene Ministerialbeamte Armand Freiherr von Dumreicher
Feststellungen von zeitloser Deutlichkeit getroffen, die die
angeblich so guten alten Museumszeiten wie heutige Zustände
erscheinen lassen. Zitat: >Die Sammlungstätigkeit erfolge
systemlos, die Aufstellung der Objekte erfolge konfus, auch
sei es überhaupt nie zu einer sorgfältigen Sichtung der Sammlungsbestände
gekommen, die etwa das Wertvolle vom weniger Qualitätvollen
geschieden hätte. Es gebe keinen wissenschaftlichen Katalog
der dauernd ausgestellten Bestände, was das Studium der Sammlungen
sowohl durch das Publikum als auch durch die Schüler der Kunstgewerbeschule
erschwere, ja sogar unmöglich mache. Sogar der Zettelkatalog
(das heißt das Inventar) sei lückenhaft, und da auf vielen
Objekten die Inventarnummer fehle, sei es nun überhaupt nicht
mehr möglich, bestimmte Stücke zuverlässig zu identifizieren
...<.
D. h. der >Skandal< als allseits akzeptierter Normalzustand,
die Frage nach Strukturentwicklungen als Beschäftigungstherapie,
die Überforderung jeder Neuorientierung durch uferlose, ererbte
Probleme.
Einige zusammenfassende Thesen
(als stichwortartige Auszüge aus umfangreicheren konzeptionellen
Arbeiten)
- Auf eine sehr lakonische Formel gebracht, sehe ich das
Museum als leistungsfähige Kopfstelle für interessante Projekte;
solid betreute Sammlungen sind die Basis dafür.
- Neu zu überlegen sind die Funktionen eines Museums
- als öffentliche Institution
- als Betrieb
- als Zentrum eines Kooperationsnetzwerkes (mit entsprechenden
Impulsen für die Szenerie freischaffend-geistigen Arbeitens
und diversester Zulieferungen).
- Überdies wäre es auch nicht so falsch, die zwei grassierenden
konträren >Denkschulen< auch im Detail von Tabuisierungen
zu befreien:
Die eine, die >klassische<, empfindet die angebliche Entökonomisierung
als befreiend, denn das Odium des Warencharakters kann sich
so verflüchtigen. Das Bild vom >romantischen< Sammler und
Liebhaber, der sich nie von etwas trennen würde, dem Preisentwicklungen
völlig egal sind, weil es ihm um das Objekt, um das Kunstwerk
geht, läßt sich aufrechterhalten und möglicherweise auf den
Besucher übertragen. Nachteil dabei ist, daß in einer durchökonomisierten
Welt so weder die Pflege und Bewahrung solcher Werte, noch
deren Zuwächse und Ergänzungen als Investitionen bzw. Betriebskosten
zur Vermögenssicherung und Wertsteigerung eine Verankerung
finden. Vieles bleibt nebulos ideell.
Eine zweite, sich in letzter Zeit verstärkt bemerkbar machende
Denkschule setzt genau da an und postuliert, daß erst die
Akzeptierung des Warencharakters aller dieser Dinge, und insbesonders
von Kunst, Prozesse bestärkt, die ein entsprechendes Interesse
auf sie ziehen und damit für Ankäufe, Bearbeitung, Publikationen,
Ausstellungen die adäquaten >Betriebsmittel< logisch machen
würde. In letzter Konsequenz führt dies zu Museen, die wie
Unternehmen, die >Kulturgüter< zu ihrem Gegenstand machen,
bilanzieren, die ihren Vermögensstand also regelmäßig bewerten
und die durch Käufe und Verkäufe diesbezüglich einen Handlungsspielraum
und eine >Kontrollinstanz< - den Markt eben - haben.
Auch wenn letzteres für ein Museum momentan unrealistisch
erscheint, zeigt es doch die Problematik, wie passiv - trotz
aller neuen Ansätze - staatlicherseits mit dem enormen Vermögen
der Museumsbestände umgegangen wird und auf wie wenig budgetäres
Interesse diese Werte und die Bedingungen für Wertsteigerungen
(Aufarbeitung, Restaurierung, Publikationen, Ausstellungen,
Handel) stoßen. Abbild all dessen ist der weiterhin aristokratisch-privat-schlampige
Umgang mit diesen Besitztümern (vor dem Hintergrund eines
Vermögens, dessen Wert man gar nicht genau zu kennen braucht).
Seine >bürgerliche< (kaufmännische) Variante wäre die penible
Kontoführung, die jährliche Bilanzierung, ein Interesse an
Kurssteigerungen, die Spekulation, das Arbeitenlassen von
eingesetztem Kapital. Liebhaberei kann in beiden Fällen dazutreten;
vom Staat wird sie - über die Steuergesetze - normalerweise
diskreditiert.
So oder so: Bezüglich neuer Arbeitsstrukturen könnten folgende
Prioritäten die Diskussion um Gewichtungen bestimmen:
-Sammlungen/sprich: Objekte
-Archivfunktionen/also Aufwertung von Informationssammlungen
-Ausstellungen/Veranstaltungen
-Trennung von Daueraufgaben und Projekten; Projekte nicht
als >Nebenaufgabe<, sondern als eigentlich-dynamische Elemente,
für die entsprechende Service- und Unterstützungsfunktionen
vorzusehen sind (gleichermaßen für Ausstellungsprojekte, Forschungsvorhaben,
Reorganisationsmaßnahmen etc.)
Daraus ergibt sich ein plausibler Raster für die Neuordnung
von Inhalts- und Arbeitszusammenhängen.
Es ergeben sich aus dieser Betonung einer >Projektorientierung<
aber auch markante Parallelen und Brücken zur von anderen
Referenten betonten Abwendung von nicht mehr haltbaren Auffassungen
von >Linearität< der (geschichtlichen) Abläufe. Es gehört
also auch das grassierende >lineare< Vor-sich-hin-Arbeiten
radikal in Frage gestellt, auf das notwendige Erledigen von
>Daueraufgaben< reduziert.
Museen mit stärkerer betrieblicher Autonomie brauchen - wenn
sie ernst genommen wird - neue Arbeitsstrukturen, neue Personalsysteme,
neue Budgetabläufe, neue Entscheidungsstrukturen - mit entsprechenden
Rückwirkungen auf die Berufsbilder, nicht nur der Kustoden.
>Management< ist dabei kein Modell für mich, soferne damit
nicht eine sensitiv-professionelle Prozeßsteuerung im Rahmen
neu-überdachter Verantwortlichkeiten gemeint ist, logischerweise
inklusive der notwendigen Durchsetzungstalente.
Generell und inhaltlich unmittelbar wirksam stehen für mich
projektorientierte Arbeitsweisen im Zentrum, zur Überwindung
der internen Abkapselungen, d.h. z. B. auch projektorientiertes
Sammeln (weg von der Konzentration auf einzelne Gelegenheiten),
also etwa umfassende Dokumentationen zu einem Künstler, zu
Themen; frühzeitige Bemühungen um Nachlässe, um Dokumente,
um Modelle, Prototypen, Vergängliches, um die Dokumentation
unrealisierter Projekte.
Die Strukturen gehören also in eine Richtung verändert, die
den bisher prototypischen Museumsbeamten, den Kustoden, von
seinem Dasein als passiver Sammlungsverwalter befreien, ihn
zum wissenschaftlichen Experten mit bestimmten Fachschwerpunkten
machen, der sich auf forschende Projektarbeiten konzentrieren,
der im Rahmen übergreifender Konzepte wieder seine ureigendsten
Intentionen einbringen kann.
Kontext dafür ist die Fragestellung: Was kann und müßte ein
staatliches Museum, also eine öffentliche Instanz, anders,
besser, profilierter, gründlicher ... machen, als eine in
keine vergleichbaren Verpflichtungen eingebundene Einrichtung?
Weniger dramatisch formuliert, auch wenn es simpel klingt:
Aktiv werden, wo andere vergleichbare Einrichtungen nicht
aktiv werden. / Bestehende Stärken entweder ausbauen oder
als nicht mehr kleinweise verbesserbar akzeptieren / Periodische
Neuinterpretation der Stärken und Schwächen / Bestehende Schwächen
gezielt eliminieren bzw. gebietsweise ausdrücklich in Kauf
nehmen / Bereiche ausdrücklich als abgeschlossen erklären
/ Interessensgebiete definieren / zeitlich befristete Sammlungsschwerpunkte
/ etc.
Priorität für ein Sammeln wichtiger Objekte und Dokumente,
die (noch) keinen Markt haben, die sonst verloren gehen würden,
die noch bearbeitet werden müssen; um die sich sonst kaum
wer kümmert
Politik für die Relation Ausgestelltes/Depotbestände: z.
B. Sekundär- und Tertiärsammlungen, rascherer Wechsel des
Ausgestellten, Durchforstung, Reduktion, Dauerleihgaben, Tausch,
Verkauf (von letzteren passiert einiges ohnedies, wenn auch
tabuisiert)
Das Museum als >Knotenpunkt< innerhalb von Strukturen, die
Kontinuitäten bei künstlerisch/gestalterischen Leistungen
bestärken sollen; durch Gegenwartsbezüge, als Veranstalter,
als Sammler von Objekten und Informationen, als Auftraggeber,
als Herausgeber von Publikationen etc. - Stichworte: Auftragskultur,
Projektkultur, Aktivierung und Professionalisierung des Umfeldes
(bis hin zu Druckereien, Lichttechnik, Verlagen, Grafik)
Gerade im Projektbereich müßte die angebahnte Öffnung durch
Professionalisierung der Zusammenarbeit mit freien Mitarbeitern,
mit Künstlern, der Kooperation mit sozusagen >ungewöhnlichen<
Partnern neue Stabilitäten schaffen. Der Dilletantismus dabei
ist ja fast schon sprichwörtlich (und bindet anderwärtig nutzbare
Energien).
Ausformulierte Papiere über die eigene Museumspolitik braucht
wahrscheinlich kein Haus; weil das Fließende, Prozeßhafte,
Offene Phantasievolle sich im Idealfall in Projekten ohnehin
deutlich ausdrückt - soferne formal, inhaltlich und programmatisch
Linien, die ein Haus prägen, erkennbar werden. Träger dessen
können nur Personen sein, die man arbeiten läßt. - Läßt man
sie ??
Der Kontext dazu ist die alte Frage, inwieweit veränderte
Strukturen veränderte Inhalte provozieren. Daß sie reziprok
genauso gilt, also über Inhalte Strukturen angepaßt werden,
ist für mich der fraglichere Teil dieses >Wo setze ich an<-Spieles.
Nachsatz: Knappe Budgets sind geringere Hindernisse als unerträgliche
Arbeitsstrukturen und Bürokratismen.
Damit ich nicht zu pragmatisch schließe möchte ich bezüglich
einer musealisierten >Zukunft des Erinnerns< nicht fürstliche
Kuriositätenkabinette (die wieder im Werden sind) oder glatte
Dienstleistungsmuseen (die sich Kulturmanager als Hoffnungsgebiet
wünschen) als resümierende Metapher benutzen, sondern die
eigenen Erinnerungen an ziemlich schlichte Einblicke in Sammlungsgewohnheiten,
in Sammlungsleidenschaften. Sie waren verbunden mit ängstlich-faszinierten
Forschungsreisen in bestimmte, nicht allgemein zugängliche
Räume, auf Dachböden, in Keller, in Winkel unter irgendwelchen
Stiegen, wo sich alles mögliche angesammelt hatte, mit dem
man etwas anfangen konnte.
In diesem Sinne halte ich das sozusagen klassische Museum,
das sich nicht generellen Modernisierungstrends unterwirft,
in dem aber die Aktivisten endlich animierende Arbeitsmöglichkeiten
vorfinden und auch der >Schmetterlingsforscher< nicht dauernd
seine Intentionen verteidigen muß, für das eigentliche >Szenario
künftiger Museums-arbeit<. Nur: Radikale Reformen - mit tausenden
Details - sind selbst bei dieser genügsam-konservativen Intention
einfach notwendig.
Zusammengefaßt geht es also um die Frage, welche Formen
von Statik und Dynamik (in meiner Sprache: von Strukturen
und Projekten) welche Inhalte provozieren.
|
|