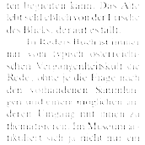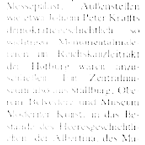|
Zur nun ein Jahrhundertquartal zurückliegenden Lokalgeschichte,
um die es hier geht, müßte es theoretisch so viele Versionen
wie Beteiligte geben. Meine ist eher abstrakt ausgefallen,
gerade weil mir Allgemeines in Textform häufig auf die Nerven
geht.
1. Befreiend wäre folgende Variante: Der durch das Jahr 1968
typisierte Mensch fehlt überall, weil er nie existiert hat.
Gebraucht wurde er nur als positiv oder negativ idealisiertes
Wesen. Präsenter als Figuren sind Wellen der Erregung und
Erfahrungen im Radikalitätswettbewerb. Zwischen abstinent
Gebliebenen und denen, die sich wenigstens phasenweise involviert
gefühlt haben, hat das anhaltende Berührungsschwierigkeiten
geschaffen.
2. Andererseits: Der undankbaren Rolle des Gegensteuerns,
mit all ihren minimalen, diffusen, rührenden Komponenten,
jede konstruktive Wirkung abzusprechen, will Umwege und Widerstände
simpel als Störung und Energievergeudung erscheinen lassen.
3. "Es würde mir nicht im Traum einfallen, einem Klub anzugehören,
der bereit wäre, mich als Mitglied zu akzeptieren." Diesen
berühmten Spruch von Groucho Marx habe ich offenbar aus frühen
Wiener Filmmuseumstagen in Erinnerung; er paßt gut auf jene,
denen damals nichts anderes übrig geblieben ist, als sich
von irgendwo wegzubewegen. Die Idee, bei Bestehendem mitzutun,
es zu können oder bloß zu wollen, haben so ziemlich alle,
mit denen ein persönlicher Kontakt möglich war, eine Zeitlang
als unangenehm empfunden. Wegen dieser Differenz ist zur Strafe
eine vermeintliche Identität verliehen worden.
4. Sonderbar bleibt, wie schwer sich diese privilegierte
Gesellschaft weiterhin mit Qualifizierungen tut und mit der
Wertschätzung liberaler Rechtsstaatlichkeit. Die dafür nötigen
Reformschübe erzeugen - sogar unter ihren Protagonisten -
immer Angst vor einer tatsächlichen Bewegung. Das lenkt Energien
um zu Epigonalem, trotz des angehäuften Wissens um geeignetere
Handlungsalternativen. Warum das so ist, weiß niemand so recht.
5. Egal um was es sich dreht: Ungefährlich gewordene Gegner
haben es gut; mit entsprechender Verzögerung ist ihnen eine
Hochachtung fast durchwegs sicher. Noch besser ergeht es Verrätern,
weil sie jene Einsicht zeigen, die ansonsten sogar in den
eigenen Reihen eher unsichtbar bleibt. Daß der ursprünglich
häufige Beruf des Doppelagenten nichteinmal mehr als Metapher
Verwendung finden kann, macht evident, wie sehr sich Spaltungen
inzwischen in einer kollektiven Introvertiertheit aufgelöst
haben.
6. Die eigene Weltfremdheit - so möchte ich behaupten - ist
auf der Suche nach ihrer Multiplikation gewesen. Das ist in
der Geschichte schon öfter vorgekommen. Daraus entstandene
Sympathien haben oft erstaunlich lange gehalten, selbst wenn
sich schließlich die sonderbarsten und banalsten Wege ergeben
haben, um mit der Realität näher bekannt zu werden
7. Von denen, die sich in meinem Blickfeld damals für einander
zu interessieren begonnen hatten, sind fast alle noch nicht
allzulang in Wien gewesen und bei wem das anders war, ist
es nicht weiter aufgefallen. Ein Handlungsmuster war auf eine
offensive Urbanisierung und Modernisierung gerichtet, mit
kühnen Projekten und mit Protesten gegen drohende Zerstörungen
(von Otto Wagner-Bauten bis zum Wittgensteinhaus). Zwischen
künstlerischen und politischen Zirkeln sind nur mühselige
Kontakte zustandegekommen, sei es bei der versuchten Burgtheaterbesetzung
oder der berühmten Aktion im Hörsaal 1.
8. Das Interesse an Unmöglichem und Übermütigem hat immer
nur momentane Höhepunkte zugelassen. Intensiv zu leben, so
ließe sich dramatisiert sagen, ist eine der gebräuchlichen
Formeln gewesen. Für einige hat das bereits funktioniert,
die meisten haben erst geübt. Fröhlicher jedenfalls sind die
Zeiten, meinem Gefühl nach, seither nicht geworden, wahrscheinlich,
weil das Mögliche sich laufend in unerwarteter Weise verwandelt
hat.
9. Da solche Sätze weder mit dem tatsächlichen Geschehen
noch mit im Gedächtnis gespeicherten Bildern wirklich übereinstimmen
und das Vertrauen in größere Erzählungen verlorengegangen
ist, braucht es Meister und Meisterinnen der kleinen Form,
um hie und da derartiges neu zu erfinden. Als Reminiszenz
erschiene es mir logisch, die Ereignisse und ihre Zwischenphasen
in irgendeine graue Stadt, die es überall hätte geben können,
zu verlegen. Ihre Bewohner merken nicht, was vor sich geht;
auch die verschiedensten Akteure begreifen immer erst später,
daß es ihnen nicht anders ergangen ist. Nur sind auch solche
Szenarien ziemlich ausgeschöpft.
10. Im Mittelalter etwa dürfte sich einiges durchaus ähnlich
abgespielt haben: Mönche, Derwische, Heilige, eigenwillige
Frauen, dunkle Spelunken, fremde Musik, ekstatischer Tanz,
verschreckte Passanten. Denkbar war auch in den hier gestreiften
Zeiten plötzlich vieles, nur bei der Arbeitsmoral sind die
Maßstäbe in unseren Gruppierungen exzessiv streng gewesen.
Bis heute konzentrieren sich die Konflikte auf dieses Thema.
Und unter Arbeit ist mitunter fast alles, um was es geht,
verstanden worden.
11. Die wenigen in jenen Jahren als Treffpunkt akzeptierten
Orte, wie das Vanilla, auf das sich dieses Verhör offenbar
bezieht, haben eine abgeschirmte Öffentlichkeit garantiert.
Ohne diese Lokale, so die eine Version, wäre manches vielleicht
anders verlaufen. Plausibler ist die Annahme, daß es sie auf
jeden Fall gegeben hätte, als Notwendigkeit. Über Beziehungen
zu und zwischen damals beteiligten Personen verweigere ich
die Aussage. Dazu müßte sich jeder selbst äußern. Ich würde
wahrscheinlich zu vieles durcheinanderbringen. Außerdem war
ich, wegen einsetzender Vielarbeit, bald nicht mehr allzuoft
in Wien.
12. Damalige Prägungen haben, auf Geist und Welt bezogen,
so oder so ihre Spuren hinterlassen. Im dritten Pol - nach
Paul Valéry's "Corps-Esprit-Monde"-Modell - dem Körper, ist
in meinem Fall ein immer wieder kommender Schmerz zurückgeblieben.
Irgendeine, durchaus nicht jede, kleine Überanstrengung löst
ihn aus. Er ist auszuhalten und vergeht rasch wieder. Manchmal
wird mir bewußt, wo ich ihn her habe. Er stammt aus der Strauchgasse
im ersten Wiener Gemeindebezirk und ist inzwischen gut zwanzig
Jahre alt. Dort, vor dem Vanilla, sind meine beiden Handgelenke
gebrochen, beim Sprung von einem Verkehrsschild, nach einer
überschwenglichen Rede an die Freunde, die niemandem in Erinnerung
geblieben ist. Die rechte Hand hat alles gut überstanden,
in der linken ist offenbar etwas nie wieder richtig zusammengewachsen
und das bekomme ich von Zeit zu Zeit zu spüren.
|
|