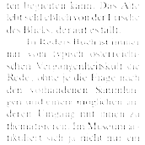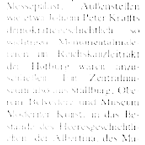|
Die Anzahl der Möglichkeiten vermehren, heißt, kybernetisch
gedacht, sich als Beobachter, als Beobachterin, ins System
zu begeben und dabei eigene Ziele zu verfolgen. Rein rechnerisch
multiplizieren sich dadurch die Varianten. Es wird aber etwas
anderes aus ihnen, weil die beteiligten Systeme auf sich selbst
bezogen reagieren. Was von außen gesehen plausibel erscheint,
transformiert sich.
Bei der Beurteilung solcher Ziele pendeln die Begriffe zwischen
positiven und negativen Werten: gut - schlecht, schön - häßlich,
wahr - unwahr, richtig - falsch, mächtig - ohnmächtig, bedeutend
- unbedeutend, reich - arm, wirkungsvoll - wirkungslos. Im
vorliegenden Projekt sind die Akteure von Negationen ausgegangen
und damit recht erfolgreich gewesen. Was sie behauptet haben
war unwahr, war falsch; zumindest in manchen Punkten. Was
sie gezeigt haben war häßlich; zumindest nach konventionellen
Vorstellungen. Worauf sie hingewiesen haben ist als schlecht,
als problematisch eingestuft worden. Mit konkreten Beispielen
haben sie erreicht, daß das Zerstörungspotential stereotyper
ökonomischer Standards besprochen worden ist. Manche Medien
- noch dazu eher gute - waren verärgert, weil sie plötzlich
Unwahres geglaubt haben. Dafür haben sich die anderen, die
immer recht haben, gefreut. Der öffentliche Raum ist für kurze
Zeit das geworden, was er sein könnte, ein Netz von Punkten,
von denen Aufmerksamkeit ausgeht.
Falsches hat sich als richtig herausgestellt. Nicht-Kommerzielles
hat sich als kommerziell nützlich erwiesen, gerade weil demonstriert
wurde, wie subtile Aktionen jeden aufwendigen Professionalismus
lächerlich machen können. Vom Schlagwort 'Privatinitiative'
sind jene Nuancen betont worden, die öffentliche Interessen
berühren. Aus der Anonymität heraus wurde dazu beigetragen,
daß Konturen sichtbar werden, Konturen des aufgegriffenen
Problems und der Bereitschaft vieler, an einer solchen Arbeit
mitzuwirken.
|
|